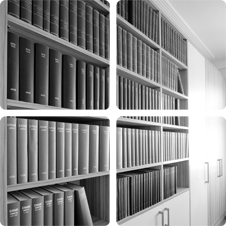Informationen aus dem Steuer-, Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht
Steuerbrief für den Monat November 2025
SPRUCH
Der Anblick eines wahrhaft Glücklichen macht glücklich.
Johann Wolfgang Goethe; 1749 – 1832, deutscher Dichter
Johann Wolfgang Goethe; 1749 – 1832, deutscher Dichter
Steueränderungsgesetz 2025
Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf des Steueränderungsgesetzes 2025 verabschiedet, Bundestag und Bundesrat sollen bis zur parlamentarischen Winterpause im Dezember zustimmen, damit die beabsichtigen Änderungen zum 1.1.2026 in Kraft treten können.
Folgende wichtige Änderungen sind im Entwurf vorgesehen:
⇑- Die Entfernungspauschale im Rahmen des Werbungskostenabzugs bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit soll auf 0,38 €/km einheitlich angehoben werden, anstatt bislang 0,30 €/km und ab dem 21. km mit 0,38 €/km.
- Für Geringverdiener soll die Mobilitätsprämie zeitlich entfristet werden. Ein Antrag auf Erstattung ab dem 21. Entfernungskilometer ist möglich, da Geringverdiener i. d. R. keine Einkommensteuer zahlen, von der sie Fahrtkosten absetzen könnten.
- Für Übungsleiter sollen steuer- und sozialversicherungsfreie Aufwandsentschädigungen von 3.000 € jährlich auf 3.300 €, für Ehrenamtliche von 840 € auf 960 € angehoben werden. Beide können nebeneinander genutzt werden, ab 2026 müssen sie der Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke dienen.
- Für gemeinnützige Organisationen steigt die Freigrenze für Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben von 45.000 € auf 50.000 €, innerhalb derer keine Körperschaft- oder Gewerbesteuer zu zahlen ist. E-Sport soll ab 2026 als gemeinnützig anerkannt werden.
- Die Stromsteuerentlastung für Land- und Forstwirte soll wieder eingeführt werden.
- Die 19 % Umsatzsteuer für Speisen auf Restaurant-/Verpflegungsdienstleistungen soll ab dem 1.1.2026 wieder auf 7 % sinken. Dies betrifft auch Cateringunternehmen, Convenience-Abteilungen etc. Für Getränke bleibt es weiterhin bei 19 %.
- Die Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau soll erhalten bleiben.
Die Aktivrente
Die sogenannte „Aktivrente“ soll als eines von mehreren Instrumenten dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Es soll Unternehmen die Möglichkeit eröffnen, ihre langjährigen Mitarbeiter noch über den Eintritt in die Altersrente hinaus beschäftigen zu können, wenn die betroffenen Arbeitnehmer dies möchten. Dem Vernehmen nach lag der auf den 9.10.2025 datierte Referentenentwurf bis zum 10.10.2025 zur Möglichkeit der Stellungnahme innerhalb eines (!) Tages bei den Fachverbänden.
Das Gesetz soll neben der Aufhebung des Anschlussverbots (befristete Beschäftigung ohne sachlichen Grund nach einer bestimmten Zeit der Beschäftigung) für Menschen ab Erreichen der Regelaltersgrenze am 1.1.2026 in Kraft treten. Nach zwei Jahren soll evaluiert werden, ob der gewünschte Erfolg eingetreten ist und das Kosten-Nutzen-Verhältnis bewertet werden.
Rentner sollen bis zu 2.000 € monatlich bzw. 24.000 € jährlich steuerfrei hinzuverdienen dürfen. Für Frührentner, Selbstständige, Landwirte, Beamte und Minijobber soll die Regelung nicht gelten, sodass bereits wegen möglicher Verstöße gegen das Gleichbehandlungsgebot sowie der Gleichmäßigkeit der Besteuerung (nach Leistungsfähigkeit) mit einer Vielzahl von Gerichtsverfahren gerechnet wird.
Die Aktivrente gilt ausweislich des Entwurfs nur für sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse bzw. Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge aus diesem Einkommen sollen wohl von Arbeitgeber und Arbeitnehmer je hälftig abgeführt werden, Rentenversicherungsbeiträge nur vom Arbeitgeber. Die Lohnsteuerbefreiung soll direkt im Lohnsteuerabzugsverfahren erfolgen, nicht erst in einer Steuererklärung. Der Lohn bzw. das Gehalt sollen also direkt steuerfrei ausgezahlt werden und unterliegen auch nicht dem Progressionsvorbehalt. Der Steuersatz auf die übrigen Einkünfte wird dadurch nicht erhöht.
Ein Inkrafttreten zum 1.1.2026 stellt ein ambitioniertes Ziel dar, da Bundestag und Bundesrat ebenfalls noch zustimmen müssen.
⇑Das Gesetz soll neben der Aufhebung des Anschlussverbots (befristete Beschäftigung ohne sachlichen Grund nach einer bestimmten Zeit der Beschäftigung) für Menschen ab Erreichen der Regelaltersgrenze am 1.1.2026 in Kraft treten. Nach zwei Jahren soll evaluiert werden, ob der gewünschte Erfolg eingetreten ist und das Kosten-Nutzen-Verhältnis bewertet werden.
Rentner sollen bis zu 2.000 € monatlich bzw. 24.000 € jährlich steuerfrei hinzuverdienen dürfen. Für Frührentner, Selbstständige, Landwirte, Beamte und Minijobber soll die Regelung nicht gelten, sodass bereits wegen möglicher Verstöße gegen das Gleichbehandlungsgebot sowie der Gleichmäßigkeit der Besteuerung (nach Leistungsfähigkeit) mit einer Vielzahl von Gerichtsverfahren gerechnet wird.
Die Aktivrente gilt ausweislich des Entwurfs nur für sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse bzw. Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge aus diesem Einkommen sollen wohl von Arbeitgeber und Arbeitnehmer je hälftig abgeführt werden, Rentenversicherungsbeiträge nur vom Arbeitgeber. Die Lohnsteuerbefreiung soll direkt im Lohnsteuerabzugsverfahren erfolgen, nicht erst in einer Steuererklärung. Der Lohn bzw. das Gehalt sollen also direkt steuerfrei ausgezahlt werden und unterliegen auch nicht dem Progressionsvorbehalt. Der Steuersatz auf die übrigen Einkünfte wird dadurch nicht erhöht.
Ein Inkrafttreten zum 1.1.2026 stellt ein ambitioniertes Ziel dar, da Bundestag und Bundesrat ebenfalls noch zustimmen müssen.
Schätzung nach amtlicher Richtsatzsammlung
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 18.6.2025 bereits zum zweiten Mal durch Urteil ein und dasselbe Verfahren zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das erstinstanzliche Finanzgericht Hamburg zurückverwiesen, im ersten Fall durch Beschluss.
Der Kläger betreibt eine Diskothek mit mehreren offenen Ladenkassen und im Wesentlichen mit Bargeschäften. Zum Feierabend wurden die offenen Ladenkassen zu einer Kasse zusammengeführt. Weitere Einzelaufzeichnungen zu den jeweiligen Kassen gab es nicht. Das Finanzamt nahm nach einer Außenprüfung eine Hinzuschätzung auf Basis der Richtsatzsammlung mit 300 % vor und bediente sich darüber hinaus zur Durchführung der Schätzung der amtsinternen „Fachinformation Betriebsprüfung für das Bundesland Nordrhein-Westfalen“, welches es dem Kläger jedoch nicht zugänglich machte.
Der Kläger setzte sich zunächst außergerichtlich und sodann gerichtlich in zwei Rechtsgängen gegen die Hinzuschätzung zur Wehr.
Da es sich bei der Richtsatzsammlung um ein vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) stammendes Verwaltungsschreiben handelt, welches auf Weisung in sämtlichen Finanzbehörden zur Hinzuschätzung genutzt wird, ist das BMF dem Rechtsstreit auf Aufforderung des BFH beigetreten, mit der Folge, dass eine gerichtliche Entscheidung sich auch für oder gegen dieses richtet.
Der BFH hat entschieden, dass eine Diskothek keiner in der Richtsatzsammlung genannten Gefahrenklasse zuzuordnen ist. Auch sei der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden, nachdem dem Kläger die Fachinformation nicht zugänglich gemacht wurde.
Grundsätzlich könne bei Mängeln in der Kassen- und Buchführung zwar hinzugeschätzt werden, dieses müsse aber genau begründet werden. Die genauere Schätzmethode ist der ungenaueren vorzuziehen. Das Ergebnis müsse nachvollziehbar begründet werden. Das sei hier jedoch nicht erfolgt.
Bedient sich die Finanzverwaltung zum Zwecke der Schätzung Vergleichsdatenbanken, verweigert jedoch aus Datenschutzgründen, unter Berufung auf das Steuergeheimnis oder aus anderen Gründen deren Offenlegung oder bleibt diese nicht nachvollziehbar, so geht dies zu Lasten der Finanzverwaltung. So war es im vorliegenden Fall. Es bestehen zumindest erhebliche Zweifel, ob eine Richtsatzsammlung eine geeignete Schätzungsgrundlage darstellt.
Betroffene sollten bei derart komplexen Fragen immer eine rechtliche und steuerliche Beratung in Anspruch nehmen.
⇑Der Kläger betreibt eine Diskothek mit mehreren offenen Ladenkassen und im Wesentlichen mit Bargeschäften. Zum Feierabend wurden die offenen Ladenkassen zu einer Kasse zusammengeführt. Weitere Einzelaufzeichnungen zu den jeweiligen Kassen gab es nicht. Das Finanzamt nahm nach einer Außenprüfung eine Hinzuschätzung auf Basis der Richtsatzsammlung mit 300 % vor und bediente sich darüber hinaus zur Durchführung der Schätzung der amtsinternen „Fachinformation Betriebsprüfung für das Bundesland Nordrhein-Westfalen“, welches es dem Kläger jedoch nicht zugänglich machte.
Der Kläger setzte sich zunächst außergerichtlich und sodann gerichtlich in zwei Rechtsgängen gegen die Hinzuschätzung zur Wehr.
Da es sich bei der Richtsatzsammlung um ein vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) stammendes Verwaltungsschreiben handelt, welches auf Weisung in sämtlichen Finanzbehörden zur Hinzuschätzung genutzt wird, ist das BMF dem Rechtsstreit auf Aufforderung des BFH beigetreten, mit der Folge, dass eine gerichtliche Entscheidung sich auch für oder gegen dieses richtet.
Der BFH hat entschieden, dass eine Diskothek keiner in der Richtsatzsammlung genannten Gefahrenklasse zuzuordnen ist. Auch sei der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden, nachdem dem Kläger die Fachinformation nicht zugänglich gemacht wurde.
Grundsätzlich könne bei Mängeln in der Kassen- und Buchführung zwar hinzugeschätzt werden, dieses müsse aber genau begründet werden. Die genauere Schätzmethode ist der ungenaueren vorzuziehen. Das Ergebnis müsse nachvollziehbar begründet werden. Das sei hier jedoch nicht erfolgt.
Bedient sich die Finanzverwaltung zum Zwecke der Schätzung Vergleichsdatenbanken, verweigert jedoch aus Datenschutzgründen, unter Berufung auf das Steuergeheimnis oder aus anderen Gründen deren Offenlegung oder bleibt diese nicht nachvollziehbar, so geht dies zu Lasten der Finanzverwaltung. So war es im vorliegenden Fall. Es bestehen zumindest erhebliche Zweifel, ob eine Richtsatzsammlung eine geeignete Schätzungsgrundlage darstellt.
Betroffene sollten bei derart komplexen Fragen immer eine rechtliche und steuerliche Beratung in Anspruch nehmen.
Entgelttransparenz ab 2026
Bis 7.6.2026 muss die EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz in nationales Recht umgesetzt sein und an das seit 2017 geltende Entgelttransparenzgesetz angepasst werden. Ziele sind die Verhinderung geschlechtsspezifischer Lohndiskriminierung und die Förderung der Gehaltstransparenz.
Das bisherige Gesetz betrifft Unternehmen ab 200 Beschäftigten, ab 500 Beschäftigten besteht eine Meldepflicht zur Entgeltgleichheit. Geschlechtsspezifische Gehaltsdifferenzen sollen behoben und Gehaltsstrukturen analysiert werden.
Gerichte haben auf Basis der bislang geltenden Regelungen Arbeitnehmerinnen einen Anspruch auf gleichen Lohn für gleiche bzw. gleichwertige Arbeit zuerkannt. So hatte ein Gericht einer Arbeitnehmerin, die sich auf das Entgelttransparenzgesetz berufen hatte, einen höheren Lohn zugesprochen, da die männliche Vergleichsgruppe eine höhere Vergütung erhielt. Der Arbeitgeber hatte nicht hinreichend dargelegt und bewiesen, in welcher Weise z. B. Kriterien wie Berufserfahrung, Betriebszugehörigkeit und Arbeitsqualität bewertet und gewichtet wurden, um die Einhaltung des Grundsatzes der Entgeltgleichheit sicherzustellen.
In Unternehmen ab 200 Beschäftigten besteht ein Anspruch auf Anfrage nach dem Vergleichsentgelt aus einer Gruppe von mindestens 6 Personen, die gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichten. Zudem sind Unternehmen ab 500 Beschäftigten verpflichtet, zu prüfen und darüber zu berichten, ob im Unternehmen Entgeltgleichheit herrscht. Der Bericht muss nach Geschlechtern aufgegliedert sein und sowohl Voll- als auch Teilzeittätigkeiten umfassen. Die Änderungen durch die EU-Richtlinie werden dazu führen, dass ein individueller Auskunftsanspruch zum Vergleichsentgelt in allen Betrieben bestehen wird, unabhängig von der Anzahl der Mitarbeitenden. Die Auskunft muss innerhalb von 2 Monaten nach der Anfrage erteilt werden.
Ab 100 Mitarbeitenden sind die Betriebe darüber hinaus verpflichtet, einen Bericht über die Entgeltgleichheit zu erstatten, und zwar ab 7.6.2031 alle 3 Jahre. Von 150 bis 249 Mitarbeitenden gilt die Pflicht bereits ab 2027 und Unternehmen ab 250 Beschäftigten müssen die Verpflichtung ab 2027 jährlich erfüllen. Es besteht für Unternehmen ab 50 Mitarbeitenden eine Verpflichtung, über das Einstiegsgehalt und dessen Spanne bereits vor dem Bewerbungsprozess zu informieren. Basis ist immer das Vorjahr. Ob nach dem nationalen Gesetz über Gehaltskriterien informiert werden muss, ist noch unbekannt. Bewerbende dürfen nicht mehr nach ihrem vorherigen Verdienst gefragt werden.
Unternehmen ohne Tarifbindung sollten daher damit beginnen, ein transparentes und objektives Vergütungssystem einzuführen, welches gut nachvollziehbar ist. Bestehende Lohn- und Gehaltslücken müssen eruiert und behoben werden.
Unternehmen jeder Größe sind ab spätestens 7.6.2026 von den Änderungen in der Entgelttransparenz betroffen. Auch als kleines Unternehmen besteht mindestens ein Auskunftsanspruch für Beschäftigte und Bewerbende.
Es ist daher dringend anzuraten, dass Unternehmen sich zwecks Auskunfterteilung mit dem eigenen Entgeltsystem befassen.
⇑Das bisherige Gesetz betrifft Unternehmen ab 200 Beschäftigten, ab 500 Beschäftigten besteht eine Meldepflicht zur Entgeltgleichheit. Geschlechtsspezifische Gehaltsdifferenzen sollen behoben und Gehaltsstrukturen analysiert werden.
Gerichte haben auf Basis der bislang geltenden Regelungen Arbeitnehmerinnen einen Anspruch auf gleichen Lohn für gleiche bzw. gleichwertige Arbeit zuerkannt. So hatte ein Gericht einer Arbeitnehmerin, die sich auf das Entgelttransparenzgesetz berufen hatte, einen höheren Lohn zugesprochen, da die männliche Vergleichsgruppe eine höhere Vergütung erhielt. Der Arbeitgeber hatte nicht hinreichend dargelegt und bewiesen, in welcher Weise z. B. Kriterien wie Berufserfahrung, Betriebszugehörigkeit und Arbeitsqualität bewertet und gewichtet wurden, um die Einhaltung des Grundsatzes der Entgeltgleichheit sicherzustellen.
In Unternehmen ab 200 Beschäftigten besteht ein Anspruch auf Anfrage nach dem Vergleichsentgelt aus einer Gruppe von mindestens 6 Personen, die gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichten. Zudem sind Unternehmen ab 500 Beschäftigten verpflichtet, zu prüfen und darüber zu berichten, ob im Unternehmen Entgeltgleichheit herrscht. Der Bericht muss nach Geschlechtern aufgegliedert sein und sowohl Voll- als auch Teilzeittätigkeiten umfassen. Die Änderungen durch die EU-Richtlinie werden dazu führen, dass ein individueller Auskunftsanspruch zum Vergleichsentgelt in allen Betrieben bestehen wird, unabhängig von der Anzahl der Mitarbeitenden. Die Auskunft muss innerhalb von 2 Monaten nach der Anfrage erteilt werden.
Ab 100 Mitarbeitenden sind die Betriebe darüber hinaus verpflichtet, einen Bericht über die Entgeltgleichheit zu erstatten, und zwar ab 7.6.2031 alle 3 Jahre. Von 150 bis 249 Mitarbeitenden gilt die Pflicht bereits ab 2027 und Unternehmen ab 250 Beschäftigten müssen die Verpflichtung ab 2027 jährlich erfüllen. Es besteht für Unternehmen ab 50 Mitarbeitenden eine Verpflichtung, über das Einstiegsgehalt und dessen Spanne bereits vor dem Bewerbungsprozess zu informieren. Basis ist immer das Vorjahr. Ob nach dem nationalen Gesetz über Gehaltskriterien informiert werden muss, ist noch unbekannt. Bewerbende dürfen nicht mehr nach ihrem vorherigen Verdienst gefragt werden.
| Anzahl Arbeitnehmer | Arbeitnehmer & Bewerber Auskunftsanspruch | Kriterien der Gehaltsfestlegung Informationspflicht | Gender-Pay-Gap (Verdienstunterschied Frauen / Männer) Berichtspflicht |
| < 50 | ab 2026 | ? | – |
| 51–99 | ab 2026 | ab 2026 | – |
| 100–149 | ab 2026 | ab 2026 | ab 2031 (alle 3 Jahre) |
| 150–249 | ab 2026 | ab 2026 | ab 2027 (alle 3 Jahre) |
| 250–499 | ab 2026 | ab 2026 | ab 2027 (1 x jährlich) |
| > 500 | ab 2026 | ab 2026 | ab 2027 (1 x jährlich) |
Unternehmen ohne Tarifbindung sollten daher damit beginnen, ein transparentes und objektives Vergütungssystem einzuführen, welches gut nachvollziehbar ist. Bestehende Lohn- und Gehaltslücken müssen eruiert und behoben werden.
Unternehmen jeder Größe sind ab spätestens 7.6.2026 von den Änderungen in der Entgelttransparenz betroffen. Auch als kleines Unternehmen besteht mindestens ein Auskunftsanspruch für Beschäftigte und Bewerbende.
Es ist daher dringend anzuraten, dass Unternehmen sich zwecks Auskunfterteilung mit dem eigenen Entgeltsystem befassen.
Pauschalabfindung für Unterhaltsverzicht
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 9.4.2025 entschieden, dass die Übertragung eines Grundstücks auf die Ehefrau eine sogenannte freigebige Zuwendung darstellt und damit schenkungssteuerpflichtig ist. Wird im Ehevertrag ein Verzicht auf Zugewinn, nachehelichen Unterhalt und Aufteilung des ehelichen Hausrats vereinbart, stellt dies nach Auffassung des BFH keine hierfür anrechenbare Gegenleistung dar, denn derartige Ansprüche können erst dann entstehen, wenn die Ehe beendet ist.
Ein Irrtum des Zuwendenden über die Frage, ob der Verzicht der Ehefrau als Gegenleistung zu werten ist, ist nach dem Urteil des BFH irrelevant.
Im vorliegenden Fall schloss der Kläger bereits vor der Eheschließung mit seiner späteren Ehefrau einen Ehevertrag vor einem Notar. Der Güterstand der Zugewinngemeinschaft wurde vereinbart, allerdings, außer für den Todesfall, sodann wieder ausgeschlossen. Zudem wurde der Zugewinnausgleich betragsmäßig begrenzt. Beide Ehegatten verzichteten auf die Durchführung eines Zugewinnausgleichs für den Fall der Scheidung und auf etwaige Ansprüche zur Aufteilung des Hausrats.
Im Gegenzug verpflichtete sich der Kläger, innerhalb von 12 Monaten nach der Eheschließung der Ehefrau ein Hausgrundstück im Wert von mindestens 6 Mio. € zu übertragen, wobei 4,5 Mio. € auf den Unterhaltsverzicht entfallen sollten, 500.000 € auf den Verzicht zur Hausratsaufteilung und 1 Mio. € auf die abweichende Vereinbarung im Rahmen des Güterstandes.
Sollte gleichwohl Schenkungssteuer anfallen, würde der Kläger diese übernehmen. Nach der Eheschließung wurde das Grundstück übertragen. Das Finanzamt und das Finanzgericht sahen die Vorgänge als schenkungssteuerpflichtig an. Hiergegen hatte der Kläger Revision beim BFH eingelegt, die aus genannten Gründen zurückgewiesen wurde.
Sofern in Eheverträgen Verzichte auf nachehelichen Unterhalt, Zugewinn oder andere Ansprüche vereinbart werden sollen, sollte immer neben einer rechtlichen auch eine steuerliche Beratung eingeholt werden.
⇑Ein Irrtum des Zuwendenden über die Frage, ob der Verzicht der Ehefrau als Gegenleistung zu werten ist, ist nach dem Urteil des BFH irrelevant.
Im vorliegenden Fall schloss der Kläger bereits vor der Eheschließung mit seiner späteren Ehefrau einen Ehevertrag vor einem Notar. Der Güterstand der Zugewinngemeinschaft wurde vereinbart, allerdings, außer für den Todesfall, sodann wieder ausgeschlossen. Zudem wurde der Zugewinnausgleich betragsmäßig begrenzt. Beide Ehegatten verzichteten auf die Durchführung eines Zugewinnausgleichs für den Fall der Scheidung und auf etwaige Ansprüche zur Aufteilung des Hausrats.
Im Gegenzug verpflichtete sich der Kläger, innerhalb von 12 Monaten nach der Eheschließung der Ehefrau ein Hausgrundstück im Wert von mindestens 6 Mio. € zu übertragen, wobei 4,5 Mio. € auf den Unterhaltsverzicht entfallen sollten, 500.000 € auf den Verzicht zur Hausratsaufteilung und 1 Mio. € auf die abweichende Vereinbarung im Rahmen des Güterstandes.
Sollte gleichwohl Schenkungssteuer anfallen, würde der Kläger diese übernehmen. Nach der Eheschließung wurde das Grundstück übertragen. Das Finanzamt und das Finanzgericht sahen die Vorgänge als schenkungssteuerpflichtig an. Hiergegen hatte der Kläger Revision beim BFH eingelegt, die aus genannten Gründen zurückgewiesen wurde.
Sofern in Eheverträgen Verzichte auf nachehelichen Unterhalt, Zugewinn oder andere Ansprüche vereinbart werden sollen, sollte immer neben einer rechtlichen auch eine steuerliche Beratung eingeholt werden.
Fälligkeitstermine - November 2025
- Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli.-Zuschlag (mtl.): 10.11.2025
(Zahlungsschonfrist 13.11.2025) - Gewerbesteuer, Grundsteuer (VZ): 17.11.2025
(Zahlungsschonfrist 20.11.2025) - Sozialversicherungsbeiträge: 23.11.2025 (Abgabe der Erklärung - 24 Uhr)
(Zahlung 26.11.2025)
Basiszins / Verzugszins
-
Verzugszinssatz seit 1.1.2002: (§ 288 BGB)
Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern:
Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (abgeschlossen bis 28.7.2014):
Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (abgeschlossen ab 29.7.2014):
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale -
Basiszinssatz nach § 247 Abs. 1 BGB
maßgeblich für die Berechnung von Verzugszinsen
seit 01.07.2025 = 1,27 %
01.01.2025 - 30.06.2025 = 2,27 %
01.07.2024 - 31.12.2024 = 3,37 %
01.01.2024 - 30.06.2024 = 3,62 %
01.07.2023 - 31.12.2023 = 3,12 %
01.01.2023 - 30.06.2023 = 1,62 %
01.07.2016 - 31.12.2022 = - 0,88 %
01.01.2016 - 30.06.2016 = - 0,83 %
01.07.2015 - 31.12.2015 = - 0,83 %
01.01.2015 - 30.06.2015 = - 0,83 %
01.07.2014 - 31.12.2014 = - 0,73 %
01.01.2014 - 30.06.2014 = - 0,63 %
01.07.2013 - 31.12.2013 = - 0,38 %
www.destatis.de - Themen - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreise - Preisindizes im Überblick
Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, können erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt werden!
Verbraucherpreisindex
Verbraucherpreisindex (2020 = 100)
2025
122,6 September
122,3 August
122,2 Juli
121,8 Juni
121,8 Mai
121,7 April
121,2 März
120,8 Februar
120,3 Januar
2024
120,5 Dezember
119,9 November
120,2 Oktober
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreise
⇑2025
122,6 September
122,3 August
122,2 Juli
121,8 Juni
121,8 Mai
121,7 April
121,2 März
120,8 Februar
120,3 Januar
2024
120,5 Dezember
119,9 November
120,2 Oktober
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreise
Grundstücksübertragung durch GbR – Eintragung ins Gesellschaftsregister zwingend
Seit dem 1.1.2024 gilt das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts. In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall stellte sich die Frage, ob eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), die noch nach altem Recht im Grundbuch eingetragen ist, nach ihrer Auflösung Grundstücke ohne vorherige Eintragung ins neue Gesellschaftsregister auf ihre Gesellschafter übertragen kann.
Eine GbR, die bisher nach altem Recht im Grundbuch unter Nennung ihrer Gesellschafter eingetragen ist, darf seit dem 1.1.2024 ihr Grundstück nicht mehr direkt übertragen lassen.
Die GbR muss zuerst in das neue Gesellschaftsregister aufgenommen werden und sich anschließend als eingetragene GbR (eGbR) im Grundbuch eintragen lassen. Erst danach ist eine Übertragung des Grundstücks auf die Gesellschafter möglich.
Dies gilt auch dann, wenn das Grundstück der einzige Vermögenswert der GbR ist und das Eigentum auf ihre Gesellschafter übertragen werden soll mit der Folge, dass die Eintragung der eGbR als Eigentümerin im Grundbuch sogleich wieder gelöscht wird. Ob die Gesellschafter familiär miteinander verbunden sind, spielt ebenfalls keine Rolle.
⇑Eine GbR, die bisher nach altem Recht im Grundbuch unter Nennung ihrer Gesellschafter eingetragen ist, darf seit dem 1.1.2024 ihr Grundstück nicht mehr direkt übertragen lassen.
Die GbR muss zuerst in das neue Gesellschaftsregister aufgenommen werden und sich anschließend als eingetragene GbR (eGbR) im Grundbuch eintragen lassen. Erst danach ist eine Übertragung des Grundstücks auf die Gesellschafter möglich.
Dies gilt auch dann, wenn das Grundstück der einzige Vermögenswert der GbR ist und das Eigentum auf ihre Gesellschafter übertragen werden soll mit der Folge, dass die Eintragung der eGbR als Eigentümerin im Grundbuch sogleich wieder gelöscht wird. Ob die Gesellschafter familiär miteinander verbunden sind, spielt ebenfalls keine Rolle.
Handelsregistereintrag – Begriff „Geschäftsführung“ nicht erlaubt
Das Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) hat in seinem Beschl. v. 15.7.2025 klargestellt, dass für Eintragungen in das Handelsregister ausschließlich der gesetzlich vorgesehene Begriff „Geschäftsführer“ zulässig ist. Die Bezeichnung „Geschäftsführung“ genügt den Anforderungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbHG) nicht.
In dem entschiedenen Fall war eine Stadt alleinige Gesellschafterin einer GmbH. Im Zuge einer Satzungsänderung wollte die Gesellschaft ihre Vertretungsregelung sprachlich modernisieren und beantragte die folgende Fassung zur Eintragung in das Handelsregister: „Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführungen. Jede Geschäftsführung vertritt die Gesellschaft allein. Einzelnen Geschäftsführungen kann durch Beschluss des Aufsichtsrates Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.“
Die Begriffe „Geschäftsführung“ und „Geschäftsführer“ sind nicht gleichbedeutend. So muss eine GmbH nach dem GmbHG „einen oder mehrere Geschäftsführer“ haben. Der Begriff „Geschäftsführung“ ist jedoch auslegungsfähig und kann auch eine organisatorische Einheit bezeichnen. „Geschäftsführer“ hingegen benennt eindeutig die verantwortliche natürliche Person. Damit steht fest: Für Eintragungen ins Handelsregister ist zwingend die gesetzliche Terminologie zu verwenden. Kreative oder vermeintlich moderne Formulierungen wie „Geschäftsführung“ genügen den gesetzlichen Vorgaben nicht.
⇑In dem entschiedenen Fall war eine Stadt alleinige Gesellschafterin einer GmbH. Im Zuge einer Satzungsänderung wollte die Gesellschaft ihre Vertretungsregelung sprachlich modernisieren und beantragte die folgende Fassung zur Eintragung in das Handelsregister: „Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführungen. Jede Geschäftsführung vertritt die Gesellschaft allein. Einzelnen Geschäftsführungen kann durch Beschluss des Aufsichtsrates Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.“
Die Begriffe „Geschäftsführung“ und „Geschäftsführer“ sind nicht gleichbedeutend. So muss eine GmbH nach dem GmbHG „einen oder mehrere Geschäftsführer“ haben. Der Begriff „Geschäftsführung“ ist jedoch auslegungsfähig und kann auch eine organisatorische Einheit bezeichnen. „Geschäftsführer“ hingegen benennt eindeutig die verantwortliche natürliche Person. Damit steht fest: Für Eintragungen ins Handelsregister ist zwingend die gesetzliche Terminologie zu verwenden. Kreative oder vermeintlich moderne Formulierungen wie „Geschäftsführung“ genügen den gesetzlichen Vorgaben nicht.
Sonntagsverkauf von Dekorationsartikeln und Christbaumschmuck in einem Gartenmarkt
Schon im November bieten viele Gartencenter neben Pflanzen und Gartenbedarf auch Weihnachtsdekoration, Lichterketten und Christbaumschmuck an. Ob solche saisonalen Produkte die Sonntagsöffnung gefährden, hat der Bundesgerichtshof (BGH) klargestellt. Solange das Hauptsortiment Pflanzen und Gartenbedarf bleibt, ist der Verkauf von Weihnachtsartikeln am Sonntag zulässig. Denn kleinteilige Accessoires wie Dekorationsartikel und Christbaumschmuck haben gegenüber den hauptsächlich angebotenen Blumen und Pflanzen lediglich ergänzenden Charakter.
Hintergrund war ein Streit in Nordrhein-Westfalen: Ein Wettbewerbsverband hatte ein Gartencenter verklagt, weil es an einem verkaufsoffenen Sonntag auch Dekorationswaren verkaufte. Der BGH entschied, dass solche Artikel als zulässiges Randsortiment gelten und die Sonntagsöffnung nicht unrechtmäßig machen, wenn sie das Kernangebot nicht überwiegen.
Das Urteil dürfte auch über NRW hinaus Orientierung bieten, da ähnliche Regeln auch in anderen Bundesländern gelten. Händler sollten daher im Vorfeld prüfen, welche zusätzlichen Waren sie neben ihrem Kernsortiment sonntags anbieten dürfen.
⇑Hintergrund war ein Streit in Nordrhein-Westfalen: Ein Wettbewerbsverband hatte ein Gartencenter verklagt, weil es an einem verkaufsoffenen Sonntag auch Dekorationswaren verkaufte. Der BGH entschied, dass solche Artikel als zulässiges Randsortiment gelten und die Sonntagsöffnung nicht unrechtmäßig machen, wenn sie das Kernangebot nicht überwiegen.
Das Urteil dürfte auch über NRW hinaus Orientierung bieten, da ähnliche Regeln auch in anderen Bundesländern gelten. Händler sollten daher im Vorfeld prüfen, welche zusätzlichen Waren sie neben ihrem Kernsortiment sonntags anbieten dürfen.
Stichtagsregelung bei Jahressonderzahlung
In einem vom Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern (LAG) entschiedenen Fall regelte ein Manteltarifvertrag zur Jahressonderzahlung Folgendes: „Die Mitarbeiter erhalten mit dem Novemberentgelt eine Jahressonderzahlung in Höhe von 100 % des Bruttomonatstabellenentgelts. Im Jahr des Eintritts wird die Jahressonderzahlung zeitanteilig entsprechend für jeden vollen Beschäftigungsmonat zu 1/12 gezahlt.“ Das LAG hatte zu klären, ob ein vor November des Jahres ausgeschiedener Mitarbeiter einen anteiligen Anspruch auf die Jahressonderzahlung hat.
Eine tarifvertragliche Regelung, nach der Mitarbeiter mit dem Novemberentgelt eine Jahressonderzahlung erhalten, kann als Stichtagsregelung zu verstehen sein, sodass zuvor ausgeschiedene Arbeitnehmer nicht anspruchsberechtigt sind. Die LAG-Richter führten aus, dass die o. g. Regelung begrifflich voraussetzt, dass der Mitarbeiter ein Entgelt für den Monat November erhält. Das wiederum setzt ein bestehendes Arbeitsverhältnis, zumindest an einem Novembertag, voraus. Die Tarifvertragsparteien haben damit nicht nur die Fälligkeit des Anspruchs geregelt, sondern auch eine Bedingung für den Anspruch festgelegt.
Zur Höhe der Sonderzahlung führten die Richter aus, dass sie sich danach richtet, ob das Arbeitsverhältnis im laufenden Jahr neu begonnen hat oder bereits zuvor bestand. Im Eintrittsjahr berechnet sich die Jahressonderzahlung anteilig nach der Anzahl von vollen Beschäftigungsmonaten und bei zuvor begründeten Arbeitsverhältnissen beträgt sie 100 %. Für das Austrittsjahr hingegen enthält der Tarifvertrag keine Regelung zur Quotelung. Sie hatten damit erkennbar nicht die Absicht, den im Laufe des Jahres – ggf. bereits im Januar – ausgeschiedenen Arbeitnehmern eine anteilige Jahressonderzahlung zukommen zu lassen.
⇑Eine tarifvertragliche Regelung, nach der Mitarbeiter mit dem Novemberentgelt eine Jahressonderzahlung erhalten, kann als Stichtagsregelung zu verstehen sein, sodass zuvor ausgeschiedene Arbeitnehmer nicht anspruchsberechtigt sind. Die LAG-Richter führten aus, dass die o. g. Regelung begrifflich voraussetzt, dass der Mitarbeiter ein Entgelt für den Monat November erhält. Das wiederum setzt ein bestehendes Arbeitsverhältnis, zumindest an einem Novembertag, voraus. Die Tarifvertragsparteien haben damit nicht nur die Fälligkeit des Anspruchs geregelt, sondern auch eine Bedingung für den Anspruch festgelegt.
Zur Höhe der Sonderzahlung führten die Richter aus, dass sie sich danach richtet, ob das Arbeitsverhältnis im laufenden Jahr neu begonnen hat oder bereits zuvor bestand. Im Eintrittsjahr berechnet sich die Jahressonderzahlung anteilig nach der Anzahl von vollen Beschäftigungsmonaten und bei zuvor begründeten Arbeitsverhältnissen beträgt sie 100 %. Für das Austrittsjahr hingegen enthält der Tarifvertrag keine Regelung zur Quotelung. Sie hatten damit erkennbar nicht die Absicht, den im Laufe des Jahres – ggf. bereits im Januar – ausgeschiedenen Arbeitnehmern eine anteilige Jahressonderzahlung zukommen zu lassen.
EuGH – Arbeitgeber müssen Eltern behinderter Kinder unterstützen
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte einen Fall zu verhandeln, in dem eine Stationsaufsicht ihren Arbeitgeber mehrmals ersuchte, sie an einem Arbeitsplatz mit festen Arbeitszeiten einzusetzen. Dies begründete sie damit, dass sie sich um ihren schwerbehinderten, vollinvaliden Sohn kümmern müsse. Der Arbeitgeber gewährte ihr vorläufig bestimmte Anpassungen, lehnte es jedoch ab, diese Anpassungen auf Dauer zu gewähren. Die Stationsaufsicht legte Rechtsmittel ein und der Fall landete vor dem EuGH.
Die Richter des EuGH entschieden, dass sich der Schutz der Rechte behinderter Personen vor indirekter Diskriminierung auch auf Eltern behinderter Kinder erstreckt. Die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen sind so anzupassen, dass diese Eltern sich ohne die Gefahr einer mittelbaren Diskriminierung um ihr Kind kümmern können.
Denn das Verbot der mittelbaren Diskriminierung wegen einer Behinderung nach der Rahmenrichtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf gilt auch für einen Arbeitnehmer, der wegen der Unterstützung seines behinderten Kindes diskriminiert wird.
So ist dem EuGH zufolge ein Arbeitgeber, um die Gleichbehandlung der Arbeitnehmer zu gewährleisten, verpflichtet, angemessene Vorkehrungen zu treffen, damit Arbeitnehmer ihren behinderten Kindern die erforderliche Unterstützung zukommen lassen können, sofern dadurch der Arbeitgeber nicht unverhältnismäßig belastet wird. Das nationale Gericht wird daher zu prüfen haben, ob in dieser Rechtssache das Ersuchen des Arbeitnehmers den Arbeitgeber nicht unverhältnismäßig belastet hätte.
⇑Die Richter des EuGH entschieden, dass sich der Schutz der Rechte behinderter Personen vor indirekter Diskriminierung auch auf Eltern behinderter Kinder erstreckt. Die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen sind so anzupassen, dass diese Eltern sich ohne die Gefahr einer mittelbaren Diskriminierung um ihr Kind kümmern können.
Denn das Verbot der mittelbaren Diskriminierung wegen einer Behinderung nach der Rahmenrichtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf gilt auch für einen Arbeitnehmer, der wegen der Unterstützung seines behinderten Kindes diskriminiert wird.
So ist dem EuGH zufolge ein Arbeitgeber, um die Gleichbehandlung der Arbeitnehmer zu gewährleisten, verpflichtet, angemessene Vorkehrungen zu treffen, damit Arbeitnehmer ihren behinderten Kindern die erforderliche Unterstützung zukommen lassen können, sofern dadurch der Arbeitgeber nicht unverhältnismäßig belastet wird. Das nationale Gericht wird daher zu prüfen haben, ob in dieser Rechtssache das Ersuchen des Arbeitnehmers den Arbeitgeber nicht unverhältnismäßig belastet hätte.
Lichtemissionen und Nachbarschutz
Bei der Beurteilung, ob „glänzende“ und damit wegen ihrer potentiellen Störwirkung nach einer örtlichen Bauvorschrift unzulässige Dachpfannen verwendet worden sind, ist eine durchschnittliche Empfindlichkeit zugrunde zu legen.
Ob Licht von einem Grundstück für den Nachbarn noch zumutbar ist, hängt davon ab, wie schutzwürdig und schutzbedürftig die Wohnbereiche des Nachbarn sind – sowohl drinnen (Wohnräume) als auch draußen (Terrassen, Gärten).
Dabei spielt eine Rolle, ob der Nachbar sich ohne großen Aufwand und im Rahmen des Üblichen selbst schützen kann. Anders als bei Lärm oder Gerüchen kann man sich gegen Licht oft recht einfach schützen, z. B. durch Vorhänge, Jalousien, Hecken oder Rankgitter, ohne dass die Wohnqualität wesentlich leidet.
Ausgangspunkt der Beurteilung der Zumutbarkeit ist hierbei, dass selbst die Verwendung glasierter Dachziegel verbreitet und im Grundsatz nicht zu beanstanden ist. Die damit verbundenen Lichtreflexionen mögen gelegentlich als lästig empfunden werden, überschreiten jedoch im Regelfall nicht die Schwelle zur Rücksichtslosigkeit.
⇑Ob Licht von einem Grundstück für den Nachbarn noch zumutbar ist, hängt davon ab, wie schutzwürdig und schutzbedürftig die Wohnbereiche des Nachbarn sind – sowohl drinnen (Wohnräume) als auch draußen (Terrassen, Gärten).
Dabei spielt eine Rolle, ob der Nachbar sich ohne großen Aufwand und im Rahmen des Üblichen selbst schützen kann. Anders als bei Lärm oder Gerüchen kann man sich gegen Licht oft recht einfach schützen, z. B. durch Vorhänge, Jalousien, Hecken oder Rankgitter, ohne dass die Wohnqualität wesentlich leidet.
Ausgangspunkt der Beurteilung der Zumutbarkeit ist hierbei, dass selbst die Verwendung glasierter Dachziegel verbreitet und im Grundsatz nicht zu beanstanden ist. Die damit verbundenen Lichtreflexionen mögen gelegentlich als lästig empfunden werden, überschreiten jedoch im Regelfall nicht die Schwelle zur Rücksichtslosigkeit.
Ausnahme von objektbezogener Kostentrennung nur bei sachlichem Grund
Sieht die Gemeinschaftsordnung einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) eine objektbezogene Kostentrennung vor, müssen grundsätzlich nur die Wohnungseigentümer die Kosten tragen, deren Sondereigentum oder Sondernutzungsrecht in dem jeweiligen Gebäudeteil oder separaten Gebäude liegt (z. B. Kosten einer Tiefgarage).
Es widerspricht i. d. R. der ordnungsmäßigen Verwaltung, wenn die WEG durch Beschluss auch die übrigen Wohnungseigentümer an diesen Erhaltungskosten beteiligt. Etwas anderes gilt nur dann, wenn ein sachlicher Grund für die Einbeziehung der übrigen Eigentümer besteht.
⇑Es widerspricht i. d. R. der ordnungsmäßigen Verwaltung, wenn die WEG durch Beschluss auch die übrigen Wohnungseigentümer an diesen Erhaltungskosten beteiligt. Etwas anderes gilt nur dann, wenn ein sachlicher Grund für die Einbeziehung der übrigen Eigentümer besteht.
Widerruf durch Zerreißen des Testaments – Aufbewahrung im Schließfach unbeachtlich
Zerreißt der Erblasser sein Testament, liegt darin regelmäßig ein Widerruf und ist damit unwirksam. Gesetzlich wird vermutet, dass der Erblasser mit der Vernichtung die Aufhebung seiner letztwilligen Verfügung beabsichtigte. Diese Vermutung wird nicht dadurch widerlegt, dass das zerrissene Testament anschließend im Schließfach des Erblassers aufbewahrt wird.
Dieser Entscheidung vom Oberlandesgericht Frankfurt a. M. (OLG) lag der nachfolgende Sachverhalt zugrunde: Der Erblasser war verheiratet und seine Witwe beantragte einen Erbschein aufgrund gesetzlicher Erbfolge. Nach Erteilung des Erbscheins wurde jedoch ein zerrissenes Testament in dem Schließfach des Erblassers gefunden. Nun verlangte der in dem zerrissenen Testament bedachte Erbe den Erbschein einzuziehen. Die Beschwerde wiesen die Richter des OLG jedoch als unbegründet zurück.
⇑Dieser Entscheidung vom Oberlandesgericht Frankfurt a. M. (OLG) lag der nachfolgende Sachverhalt zugrunde: Der Erblasser war verheiratet und seine Witwe beantragte einen Erbschein aufgrund gesetzlicher Erbfolge. Nach Erteilung des Erbscheins wurde jedoch ein zerrissenes Testament in dem Schließfach des Erblassers gefunden. Nun verlangte der in dem zerrissenen Testament bedachte Erbe den Erbschein einzuziehen. Die Beschwerde wiesen die Richter des OLG jedoch als unbegründet zurück.
Testament – Kopie ist kein Original
Die Kopie eines Testaments kann nicht als letztwillige Verfügung angesehen werden, wenn Zweifel an der wirksamen Errichtung des „Original-Testaments“ verbleiben.
Um ein Erbrecht aus einem Testament nachzuweisen, muss i. d. R. das Original des Testaments vorgelegt werden, auf das sich der Erbe beruft. Ist das Original des Testaments jedoch ohne Willen und Zutun des Erblassers vernichtet worden, verloren gegangen oder sonst nicht auffindbar, kann ausnahmsweise auch eine Kopie des Testaments zum Nachweis des Erbrechts ausreichen. Hierfür gelten jedoch hohe Anforderungen.
Der Nachweis setzt voraus, dass die Wirksamkeit des „Original-Testaments“ bewiesen werden kann. Die Errichtung, die Form und der Inhalt des Testaments müssen so sicher nachgewiesen werden, als hätte die entsprechende Urkunde dem Gericht tatsächlich im Original vorgelegen.
In dem vom Pfälzischen Oberlandesgericht entschiedenen Fall hatten die Richter Zweifel an dem angeblichen Testament, weil Zeugen widersprüchlich über Entstehung und Ablauf berichteten, der umfangreiche Inhalt ohne Unterlagen kaum plausibel erschien und niemand gesehen hatte, dass der Verstorbene das Schriftstück eigenhändig unterschrieb. Daher konnte das Erbrecht aus der Testamentkopie nicht nachgewiesen werden.
⇑Um ein Erbrecht aus einem Testament nachzuweisen, muss i. d. R. das Original des Testaments vorgelegt werden, auf das sich der Erbe beruft. Ist das Original des Testaments jedoch ohne Willen und Zutun des Erblassers vernichtet worden, verloren gegangen oder sonst nicht auffindbar, kann ausnahmsweise auch eine Kopie des Testaments zum Nachweis des Erbrechts ausreichen. Hierfür gelten jedoch hohe Anforderungen.
Der Nachweis setzt voraus, dass die Wirksamkeit des „Original-Testaments“ bewiesen werden kann. Die Errichtung, die Form und der Inhalt des Testaments müssen so sicher nachgewiesen werden, als hätte die entsprechende Urkunde dem Gericht tatsächlich im Original vorgelegen.
In dem vom Pfälzischen Oberlandesgericht entschiedenen Fall hatten die Richter Zweifel an dem angeblichen Testament, weil Zeugen widersprüchlich über Entstehung und Ablauf berichteten, der umfangreiche Inhalt ohne Unterlagen kaum plausibel erschien und niemand gesehen hatte, dass der Verstorbene das Schriftstück eigenhändig unterschrieb. Daher konnte das Erbrecht aus der Testamentkopie nicht nachgewiesen werden.
Auffahrunfall nach Spurwechsel
Das Oberlandesgericht Frankfurt a. M. (OLG) hatte über einen Auffahrunfall auf der BAB 45 zu entscheiden. Ein Ford Ranger wechselte wegen einer Baustelle von der linken auf die mittlere Spur, brach den Spurwechsel aber ab und kehrte auf die linke Spur zurück, weil auf der mittleren Spur der Verkehr stockte. Das vorausfahrende Fahrzeug bremste bis zum Stillstand, der Ford ebenfalls kurzzeitig und das nachfolgende Fahrzeug fuhr daraufhin auf den Ford auf. Der Sachschaden betrug rund 60.000 €.
Normalerweise spricht bei Auffahrunfällen ein Anscheinsbeweis gegen den Auffahrenden. Dieser Anscheinsbeweis entfällt jedoch, wenn das vorausfahrende Fahrzeug einen bereits zur Hälfte vollzogenen Fahrstreifenwechsel plötzlich abbricht, wieder vor das nachfolgende Fahrzeug einschert und dort stark abbremst. In einem solchen Fall ist eine hälftige Haftungsverteilung (50:50) angemessen, entschieden die OLG-Richter.
Unfallbeteiligte haften je zur Hälfte bei unmittelbarem Zusammenhang der Kollision des auffahrenden Fahrzeugs mit einem abgebrochenen Spurwechsel des vorausfahrenden Fahrzeugs.
⇑Normalerweise spricht bei Auffahrunfällen ein Anscheinsbeweis gegen den Auffahrenden. Dieser Anscheinsbeweis entfällt jedoch, wenn das vorausfahrende Fahrzeug einen bereits zur Hälfte vollzogenen Fahrstreifenwechsel plötzlich abbricht, wieder vor das nachfolgende Fahrzeug einschert und dort stark abbremst. In einem solchen Fall ist eine hälftige Haftungsverteilung (50:50) angemessen, entschieden die OLG-Richter.
Unfallbeteiligte haften je zur Hälfte bei unmittelbarem Zusammenhang der Kollision des auffahrenden Fahrzeugs mit einem abgebrochenen Spurwechsel des vorausfahrenden Fahrzeugs.
Anforderung von Unterlagen durch das Finanzamt zulässig
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu befinden, ob die Anforderung von Mietverträgen, Nebenkostenabrechnungen, Mieterhöhungsschreiben, Belegen über Erhaltungsaufwand und ähnlichen Unterlagen durch das Finanzamt bei einem Vermieter von Wohnraum zulässig ist bzw. der Vermieter die Vorlage ohne Zustimmung des Mieters verweigern darf.
Eine Vermieterin hatte die Herausgabe unter Hinweis auf die fehlende Einwilligung des Mieters und nach ihrer Auffassung daraus folgenden Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) abgelehnt. Das Finanzamt hatte die Anforderung der Unterlagen mit steuerlicher Relevanz begründet.
Der BFH entschied, dass eine Anforderung von Unterlagen zum Mietverhältnis durch das Finanzamt zwar datenschutzrechtlich relevant sei, ein Vermieter allerdings nach der Abgabenordnung zur Vorlage bei steuerlicher Relevanz verpflichtet sei, in der Regel vollständig und ungeschwärzt. Das Finanzamt müsse begründen, warum eine steuerliche Relevanz vorliege und die angeforderten Unterlagen genau bezeichnen. In diesem Fall wiege das Interesse des Finanzamtes höher als das mögliche Datenschutzinteresse eines Mieters.
Vermieter sollten demnach immer nur die konkret bezeichneten Unterlagen herausgeben, um nicht mit der DSGVO in Konflikt zu geraten.
Wichtige Unterlagen, die angefordert werden können, sind:
Mietvertrag und Mieterhöhungen
Nebenkostenabrechnungen
Belege zu Instandhaltungs- und Erhaltungsaufwand
Belege über die Mieteinnahmen, z. B. Kontoauszüge
Eine Anforderung von Unterlagen, die steuerlich nicht relevant sind, ist nicht zulässig. Das Finanzamt muss verhältnismäßig vorgehen und darf keine Ausforschung anhand beliebiger Unterlagen betreiben. Herausgaben von derart angeforderten Unterlagen sind daher nicht notwendig.
⇑Eine Vermieterin hatte die Herausgabe unter Hinweis auf die fehlende Einwilligung des Mieters und nach ihrer Auffassung daraus folgenden Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) abgelehnt. Das Finanzamt hatte die Anforderung der Unterlagen mit steuerlicher Relevanz begründet.
Der BFH entschied, dass eine Anforderung von Unterlagen zum Mietverhältnis durch das Finanzamt zwar datenschutzrechtlich relevant sei, ein Vermieter allerdings nach der Abgabenordnung zur Vorlage bei steuerlicher Relevanz verpflichtet sei, in der Regel vollständig und ungeschwärzt. Das Finanzamt müsse begründen, warum eine steuerliche Relevanz vorliege und die angeforderten Unterlagen genau bezeichnen. In diesem Fall wiege das Interesse des Finanzamtes höher als das mögliche Datenschutzinteresse eines Mieters.
Vermieter sollten demnach immer nur die konkret bezeichneten Unterlagen herausgeben, um nicht mit der DSGVO in Konflikt zu geraten.
Wichtige Unterlagen, die angefordert werden können, sind:
Mietvertrag und Mieterhöhungen
Nebenkostenabrechnungen
Belege zu Instandhaltungs- und Erhaltungsaufwand
Belege über die Mieteinnahmen, z. B. Kontoauszüge
Eine Anforderung von Unterlagen, die steuerlich nicht relevant sind, ist nicht zulässig. Das Finanzamt muss verhältnismäßig vorgehen und darf keine Ausforschung anhand beliebiger Unterlagen betreiben. Herausgaben von derart angeforderten Unterlagen sind daher nicht notwendig.
Geschenkt: Einlage des Familienheims in eine GbR
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu entscheiden, ob die Einbringung eines Familien-heims durch einen Alleineigentümer-Ehegatten in eine GbR, an der beide Ehegatten je zur Hälfte beteiligt sind, zur Festsetzung von Schenkungsteuer gegenüber dem anderen, beschenkten Ehegat-ten führt. Im notariellen Vertrag wurde die Einbringung als unentgeltliche, ehebedingte Zuwen-dung der Ehefrau an den Ehemann, den Kläger, bezeichnet. Beide Eheleute wurden als Gesell-schafter und Eigentümer des Grundstücks in das Grundbuch eingetragen.
Das Finanzamt (FA) hatte, obwohl unstreitig war, dass es sich um ein Familienheim handelte, Schenkungsteuer gegen den Kläger als Begünstigten festgesetzt. Die Voraussetzungen für das Bestehen eines Familienheims sind u. a., dass die Wohnung den Lebensmittelpunkt darstellen muss, Nutzung durch den Schenker bis zur Schenkung und anschließende Nutzung durch den Beschenkten. Zur Begründung führte das FA an, dass wegen der Übertragung der Immobilie auf die GbR die Steuerfreiheit eines Familienheims nicht anwendbar sei. Die Hälfte sei dem Kläger zuzurechnen und Schenkungsteuer zu erheben. Der Einspruch blieb erfolglos. Das erstinstanzliche Finanzgericht gab der Klage statt und änderte die Schenkungsteuer auf 0 € mit der Begründung, dass auch der Erwerb von Gesamthandseigentum steuerfrei als Familienheim möglich sei. Der BFH sah die Revision des FA als unbegründet an und wies sie zurück.
Nach Auffassung des BFH ist bei einer GbR der einzelne Gesellschafter Steuerschuldner und nicht die Gesamthandgemeinschaft, obwohl die GbR teilrechts- und eintragungsfähig ist. Demnach ist ein bebautes Grundstück auch ein Familienheim, welches den inneren Kern der Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft eines Paares betrifft. Dieses hat der Gesetzgeber ausdrücklich privilegiert und steuerfrei gestellt.
⇑Das Finanzamt (FA) hatte, obwohl unstreitig war, dass es sich um ein Familienheim handelte, Schenkungsteuer gegen den Kläger als Begünstigten festgesetzt. Die Voraussetzungen für das Bestehen eines Familienheims sind u. a., dass die Wohnung den Lebensmittelpunkt darstellen muss, Nutzung durch den Schenker bis zur Schenkung und anschließende Nutzung durch den Beschenkten. Zur Begründung führte das FA an, dass wegen der Übertragung der Immobilie auf die GbR die Steuerfreiheit eines Familienheims nicht anwendbar sei. Die Hälfte sei dem Kläger zuzurechnen und Schenkungsteuer zu erheben. Der Einspruch blieb erfolglos. Das erstinstanzliche Finanzgericht gab der Klage statt und änderte die Schenkungsteuer auf 0 € mit der Begründung, dass auch der Erwerb von Gesamthandseigentum steuerfrei als Familienheim möglich sei. Der BFH sah die Revision des FA als unbegründet an und wies sie zurück.
Nach Auffassung des BFH ist bei einer GbR der einzelne Gesellschafter Steuerschuldner und nicht die Gesamthandgemeinschaft, obwohl die GbR teilrechts- und eintragungsfähig ist. Demnach ist ein bebautes Grundstück auch ein Familienheim, welches den inneren Kern der Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft eines Paares betrifft. Dieses hat der Gesetzgeber ausdrücklich privilegiert und steuerfrei gestellt.
Workation: Was Arbeitgeber und Arbeitnehmer beachten müssen
Ermöglichen in Deutschland ansässige Unternehmen ihrer Belegschaft das kurzfristige mobile Arbeiten aus dem Ausland, auch Workation genannt, ist dies für viele Jobsuchende eines von mehreren Kriterien, sich für oder gegen eine Arbeitsaufnahme in dem betreffenden Unternehmen oder für einen Jobwechsel zu entscheiden. Mittlerweile erwarten laut einer Workation-Studie deutlich mehr als die Hälfte der Beschäftigten von ihren Arbeitgebern, dass mobiles Arbeiten nicht nur im Inland, sondern auch aus dem Ausland ermöglicht wird.
Gleichwohl sind sowohl die Unternehmen als auch die Beschäftigten oft nicht hinreichend über die rechtlichen und steuerlichen Voraussetzungen und Folgen informiert. In den Arbeitsverträgen und Zusatzvereinbarungen finden sich häufig keine rechtssicheren Vereinbarungen.
Deutlich definierte Regelungen sind allein aus Haftungsgründen sehr wichtig. Die Unternehmen sollten daher steuer-, arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Regelungen vorab prüfen bzw. prüfen lassen. Workation ist deutlich abzugrenzen von einer dauerhaften Tätigkeit im Ausland für das Unternehmen, aber auch die Arbeit in einer ausländischen Niederlassung eines deutschen Unternehmens stellt keine Workation dar.
Folgende Punkte sollten vorab geklärt bzw. vertraglich vereinbart werden:
Achtung: Wer ohne Arbeitserlaubnis arbeitet, gilt als illegal beschäftigt, kann ggf. ausgewiesen und mit Einreiseverboten belegt werden. Für den Arbeitgeber kann ein derartiges Vorgehen zu einer Gewerbeuntersagung mit hohen Bußgeldern führen.
Die Beachtung der sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen und Folgen sind ebenfalls wichtig.
Wenn ein Arbeitgeber einer Workation im EU-Ausland zustimmt, gilt dieser Umstand sozialversicherungsrechtlich als Entsendung. Der Arbeitgeber verpflichtet sich damit, für das Bestehen eines Krankenversicherungsschutzes seiner Mitarbeiter und der mitreisenden Familienangehörigen zu haften bzw. dafür Sorge zu tragen, dass dieser besteht.
Die vorübergehende Entsendung eines Mitarbeiters aus Deutschland im Auftrag des inländischen Unternehmens in das europäische Ausland muss im Voraus zeitlich befristet sein. Das Entgelt muss in Deutschland abgerechnet werden. Eine Auslandsentsendung liegt nicht vor, wenn die entsandte Person im Ausland lebt und von einem deutschen Unternehmen für eine Tätigkeit in ihrem Heimatstaat oder einem anderen Land eingestellt wird. Die Person darf vor der Tätigkeit nicht in Deutschland beschäftigt gewesen sein oder zuvor in Deutschland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt gehabt haben.
⇑Gleichwohl sind sowohl die Unternehmen als auch die Beschäftigten oft nicht hinreichend über die rechtlichen und steuerlichen Voraussetzungen und Folgen informiert. In den Arbeitsverträgen und Zusatzvereinbarungen finden sich häufig keine rechtssicheren Vereinbarungen.
Deutlich definierte Regelungen sind allein aus Haftungsgründen sehr wichtig. Die Unternehmen sollten daher steuer-, arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Regelungen vorab prüfen bzw. prüfen lassen. Workation ist deutlich abzugrenzen von einer dauerhaften Tätigkeit im Ausland für das Unternehmen, aber auch die Arbeit in einer ausländischen Niederlassung eines deutschen Unternehmens stellt keine Workation dar.
Folgende Punkte sollten vorab geklärt bzw. vertraglich vereinbart werden:
- Innerbetriebliche Regelungen sollten klarstellen, welche Beschäftigungsgruppen das Workation-Angebot nutzen können.
- Bei einer vorübergehenden Workation bis zu 4 Wochen gilt deutsches Arbeitsrecht, Feiertage am Arbeitsort gelten auch für den Beschäftigten.
- Bei einer länger als 4 Wochen andauernden Workation muss das Unternehmen den Beschäftigten einen schriftlichen Nachweis hierüber sowie weitere Angaben aushändigen, z. B. über die Dauer des Aufenthalts und die Währung, in der das Arbeitsentgelt gezahlt wird (Nachweisgesetz).
- Bei einer mehr als 6 Monate andauernden Workation gilt das Arbeitsrecht des Workation-Landes im Hinblick auf Entlohnung, Kündigungsfristen, Arbeitszeiten und Urlaubsansprüche.
- Längere Workation in Nicht-EU-Ländern führen i. d. R. zur Notwendigkeit eines Visums, ein Touristenvisum ist nicht ausreichend. Ggf. ist ein Arbeits- oder spezielles Workationsvisum zu beantragen, welches es in einigen Ländern bereits gibt.
Achtung: Wer ohne Arbeitserlaubnis arbeitet, gilt als illegal beschäftigt, kann ggf. ausgewiesen und mit Einreiseverboten belegt werden. Für den Arbeitgeber kann ein derartiges Vorgehen zu einer Gewerbeuntersagung mit hohen Bußgeldern führen.
- Innerhalb der EU, der EWR und der Schweiz können Beschäftigte sich zu Arbeitszwecken uneingeschränkt aufhalten. Ein Visum wird nicht benötigt. Allerdings sind in den meisten Ländern Melde- oder Registrierpflichten zu beachten.
- Wer max. 183 Tage im Jahr im Ausland arbeitet, bleibt in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, bei längerem Aufenthalt entsteht die Steuerpflicht im Ausland.
- Dauert eine Workation länger als 4 Wochen, muss insbesondere der Arbeitgeber arbeits- und steuerrechtliche Folgen beachten. Hierüber sollte der Arbeitgeber sich auch immer selbstständig informieren.
Die Beachtung der sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen und Folgen sind ebenfalls wichtig.
- Bei einer Workation im Drittland - außerhalb der EU - muss geprüft werden, ob zwischen Deutschland und dem jeweiligen Staat ein Sozialversicherungsabkommen besteht. Diese Information sollte rechtzeitig eingeholt werden. Beratung bzw. Rücksprache mit einer Fachkraft in Auslandsentsendungsfragen ist hier hilfreich.
- Bei einer Workation innerhalb der EU, EWR oder Schweiz benötigt der Arbeitnehmer eine sog. A1-Bescheinigung, die dem Nachweis der Versicherungszugehörigkeit dient und elektronisch vom Arbeitgeber oder Arbeitnehmer beantragt werden kann.
- Zu beachten ist, dass auch Grenzgänger seit 2025 eine solche A1-Bescheinigung benötigen, selbst wenn keine Workation stattfindet.
Wenn ein Arbeitgeber einer Workation im EU-Ausland zustimmt, gilt dieser Umstand sozialversicherungsrechtlich als Entsendung. Der Arbeitgeber verpflichtet sich damit, für das Bestehen eines Krankenversicherungsschutzes seiner Mitarbeiter und der mitreisenden Familienangehörigen zu haften bzw. dafür Sorge zu tragen, dass dieser besteht.
Die vorübergehende Entsendung eines Mitarbeiters aus Deutschland im Auftrag des inländischen Unternehmens in das europäische Ausland muss im Voraus zeitlich befristet sein. Das Entgelt muss in Deutschland abgerechnet werden. Eine Auslandsentsendung liegt nicht vor, wenn die entsandte Person im Ausland lebt und von einem deutschen Unternehmen für eine Tätigkeit in ihrem Heimatstaat oder einem anderen Land eingestellt wird. Die Person darf vor der Tätigkeit nicht in Deutschland beschäftigt gewesen sein oder zuvor in Deutschland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt gehabt haben.
Bundesfinanzhof entscheidet zur Grundsteuer im „Bundesmodell“
Der Bundesfinanzhof wird am 10.12.2025 (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) in drei Verfahren öffentlich seine Entscheidungen verkünden.
Dies ist insbesondere für Grundstückseigentümer in den Bundesländern interessant, welche die Grundsteuerreform nach dem Bundesmodell umgesetzt haben. Dies sind die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Das Saarland und Sachsen nutzen ebenfalls die Bundesregelungen mit Abweichungen bei der Steuermesszahl.
Das Bundesmodell stellt den Grundstückwert für Wohngrundstücke anhand der Grundstücks- und Wohnfläche sowie des Bodenrichtwerts, Gebäudeart und Baujahr fest. Die drei Verfahren, die zur Entscheidung anstehen, haben gemeinsam, dass die Verfassungsmäßigkeit des für Grundsteuerzwecke pauschalierten Ertragswertverfahrens streitig ist.
Das pauschalierte Ertragswertverfahren findet Anwendung auf Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke und Eigentumswohnungen. Auch für die Erbschaft- und Schenkungsteuer wird teilweise das Ertragswertverfahren angewendet, allerdings im Gegensatz zur Grundsteuer wird dort z. B. nach den tatsächlichen Nettomieten bewertet und nicht nach landeseinheitlich geltenden Nettokaltmieten. Eine Unterscheidung gibt es bei der Grundsteuer lediglich nach Gebäudeart, Baujahr und Wohnflächengruppe, die über Zu- und Abschläge zum Ausdruck gebracht werden. So findet z. B. auch keine Unterscheidung der Mietniveaustufen nach Stadtlage oder ländlicher Lage statt.
Die Frage, die der BFH zu beantworten haben wird, ist, ob es mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist, in einer Vielzahl von Grundsteuerverfahren mit einem grob vereinfachten Verfahrensansatz wie durch Gutachterausschüsse festgestellte Bodenrichtwerte und pauschalierte Nettokaltmieten den Wert eines Grundstücks bzw. einer Wohneinheit zu bestimmen.
Es sind derzeit ca. 2.000 Klageverfahren zu unterschiedlichen Grundsteuermodellen rechtshängig, beim BFH sind es 15 Verfahren.
⇑Dies ist insbesondere für Grundstückseigentümer in den Bundesländern interessant, welche die Grundsteuerreform nach dem Bundesmodell umgesetzt haben. Dies sind die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Das Saarland und Sachsen nutzen ebenfalls die Bundesregelungen mit Abweichungen bei der Steuermesszahl.
Das Bundesmodell stellt den Grundstückwert für Wohngrundstücke anhand der Grundstücks- und Wohnfläche sowie des Bodenrichtwerts, Gebäudeart und Baujahr fest. Die drei Verfahren, die zur Entscheidung anstehen, haben gemeinsam, dass die Verfassungsmäßigkeit des für Grundsteuerzwecke pauschalierten Ertragswertverfahrens streitig ist.
Das pauschalierte Ertragswertverfahren findet Anwendung auf Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke und Eigentumswohnungen. Auch für die Erbschaft- und Schenkungsteuer wird teilweise das Ertragswertverfahren angewendet, allerdings im Gegensatz zur Grundsteuer wird dort z. B. nach den tatsächlichen Nettomieten bewertet und nicht nach landeseinheitlich geltenden Nettokaltmieten. Eine Unterscheidung gibt es bei der Grundsteuer lediglich nach Gebäudeart, Baujahr und Wohnflächengruppe, die über Zu- und Abschläge zum Ausdruck gebracht werden. So findet z. B. auch keine Unterscheidung der Mietniveaustufen nach Stadtlage oder ländlicher Lage statt.
Die Frage, die der BFH zu beantworten haben wird, ist, ob es mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist, in einer Vielzahl von Grundsteuerverfahren mit einem grob vereinfachten Verfahrensansatz wie durch Gutachterausschüsse festgestellte Bodenrichtwerte und pauschalierte Nettokaltmieten den Wert eines Grundstücks bzw. einer Wohneinheit zu bestimmen.
Es sind derzeit ca. 2.000 Klageverfahren zu unterschiedlichen Grundsteuermodellen rechtshängig, beim BFH sind es 15 Verfahren.
Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge wird verlängert
Das Bundeskabinett hat am 15.10.2025 beschlossen, dass die KFZ-Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 2035 verlängert werden soll. Die erste Lesung im Bundestag hat am 14.11.2025 stattgefunden. Der Gesetzentwurf wurde zur weiteren Debatte in die Fachausschüsse verwiesen.
Die Steuerbefreiung soll für Fahrzeuge gelten, die spätestens bis zum 31.12.2030 erstmalig für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen werden. Die Steuerbefreiung gilt bis zu 10 Jahre, längstens jedoch bis zum 31.12.2035.
Die Stellungnahme des Bundesrates steht noch aus.
Ohne eines Änderung des Gesetzes wären nur noch reine Elektrofahrzeuge von der KFZ-Steuer befreit, die vor dem 1.1.2026 erstmalig zugelassen werden.
⇑Die Steuerbefreiung soll für Fahrzeuge gelten, die spätestens bis zum 31.12.2030 erstmalig für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen werden. Die Steuerbefreiung gilt bis zu 10 Jahre, längstens jedoch bis zum 31.12.2035.
Die Stellungnahme des Bundesrates steht noch aus.
Ohne eines Änderung des Gesetzes wären nur noch reine Elektrofahrzeuge von der KFZ-Steuer befreit, die vor dem 1.1.2026 erstmalig zugelassen werden.
Die Frühstartrente
Die sogenannte Frühstartrente soll in Deutschland eingeführt werden und darauf abzielen, Eltern bei der frühzeitigen Altersvorsorge ihrer Kinder zu unterstützen und hierdurch von Zinseszinseffekten zu profitieren. Hierdurch soll das Rentensystem für die Zukunft entlastet werden. Ob diese, wie zunächst angedacht, Anfang 2026 in Kraft treten kann, ist derzeit unklar, da bislang kein Referenten- oder Gesetzesentwurf vorliegt. Es soll eine Verknüpfung der Frühstartrente mit einer Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge erfolgen.
Kinder ab dem 6. Lebensjahr sollen offenbar ohne Antrag ein staatlich gefördertes Wertpapierdepot erhalten, in das zwischen dem 6. und 18. Lebensjahr monatlich 10 € eingezahlt werden. Ab dem 18. Lebensjahr können dann durch das nunmehr volljährige Kind ab 50 € bis zu 100 € monatlich in den Vertrag eingezahlt werden. Anders lautende Vorschläge aus der Versicherungswirtschaft liegen vor.
Bei einer angenommenen gewogenen Rendite von 6 % pro Jahr und ohne jegliche eigene Einzahlungen ergibt sich laut nachfolgendem Beispiel 1 ein Rentenkapital von ca. 36.000 € bzw. über 20 Jahre eine monatliche Rente von 216 €. Im Beispiel 2 wird ab dem 18. Lebensjahr von der Annahme ausgegangen, dass monatlich 100 € in den Vertrag eingezahlt werden, sodass sich zusätzlich zu dem staatlichen Zuschuss ein Rentenkapital von ca. 374.000 € ergibt bzw. eihne monatliche Rente von 2.200 €.
Der Vertrag kann vor dem 67. Lebensjahr nicht aufgelöst und das Kapital auch nicht für andere Zwecke verwendet werden. Gesetzt den Fall, das Renteneintrittsalter würde sich z. B. auf 70 Jahre erhöhen, würde sich im Beispiel 1 das Rentenkapital wegen der um 3 Jahre längeren Liegezeit geringfügig erhöhen, während es sich im Beispielsfall 2 durch die höheren Einzahlungen mehr erhöht. Zu dem Thema „Steuerpflicht der Erträge“ gibt es noch keine Aussage.
Welche erbrechtlichen Vorstellungen der Gesetzgeber z. B. für den Fall des Todes des Berechtigten vor (vollständigem) Bezug der Rente hat, ist noch nicht bekannt.
⇑Kinder ab dem 6. Lebensjahr sollen offenbar ohne Antrag ein staatlich gefördertes Wertpapierdepot erhalten, in das zwischen dem 6. und 18. Lebensjahr monatlich 10 € eingezahlt werden. Ab dem 18. Lebensjahr können dann durch das nunmehr volljährige Kind ab 50 € bis zu 100 € monatlich in den Vertrag eingezahlt werden. Anders lautende Vorschläge aus der Versicherungswirtschaft liegen vor.
Bei einer angenommenen gewogenen Rendite von 6 % pro Jahr und ohne jegliche eigene Einzahlungen ergibt sich laut nachfolgendem Beispiel 1 ein Rentenkapital von ca. 36.000 € bzw. über 20 Jahre eine monatliche Rente von 216 €. Im Beispiel 2 wird ab dem 18. Lebensjahr von der Annahme ausgegangen, dass monatlich 100 € in den Vertrag eingezahlt werden, sodass sich zusätzlich zu dem staatlichen Zuschuss ein Rentenkapital von ca. 374.000 € ergibt bzw. eihne monatliche Rente von 2.200 €.
Der Vertrag kann vor dem 67. Lebensjahr nicht aufgelöst und das Kapital auch nicht für andere Zwecke verwendet werden. Gesetzt den Fall, das Renteneintrittsalter würde sich z. B. auf 70 Jahre erhöhen, würde sich im Beispiel 1 das Rentenkapital wegen der um 3 Jahre längeren Liegezeit geringfügig erhöhen, während es sich im Beispielsfall 2 durch die höheren Einzahlungen mehr erhöht. Zu dem Thema „Steuerpflicht der Erträge“ gibt es noch keine Aussage.
Welche erbrechtlichen Vorstellungen der Gesetzgeber z. B. für den Fall des Todes des Berechtigten vor (vollständigem) Bezug der Rente hat, ist noch nicht bekannt.
| Beispiel 1: Nur staatliche Förderung (ohne Eigenbeiträge) | |
| Einzahlung (6. bis 18. Lebensjahr) | 1.440 € (10 €/Monat) |
| Rendite | 6,00 %/Jahr |
| Zeitraum (18. bis 67. Lebensjahr) | 49 Jahre |
| Endvermögen | ca. 36.000 € |
| Rente | 216 €/Monat über 20 Jahre |
| Beispiel 2: Staat + Eigenbeiträge (100 €/Monat ab 18) | |
| Einzahlung (6. bis 18. Lebensjahr) | 1.440 € (10 €/Monat) |
| eigene Einzahlungen (ab dem 18. Lebensjahr) | 100 €/Monat |
| Gesamteinzahlung | 60.240 € |
| Rendite | 6,00 %/Jahr |
| Zeitraum (18. bis 67. Lebensjahr) | 49 Jahre |
| Endvermögen | ca. 374.000 € |
| Rente | 2.200 €/Monat über 20 Jahre (4 % Rendite) |
Deutschlandticket 2026
Das Deutschlandticket soll auch in den Jahren 2026 – 2030 erhalten bleiben. Der aktuelle Bezugspreis von 58 € in 2025 soll lt. Vereinbarung der Verkehrsminister der Bundesländer in 2026 auf 63 € monatlich steigen. Auch im Jahr 2026 können Zuschüsse zum Deutschlandticket durch den Arbeitgeber steuer- und sozialversicherungsfrei zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden. Der Zuschuss ist auf die Höhe der Aufwendungen des Arbeitnehmers begrenzt.
⇑Beitragsbemessungsgrenzen steigen ab 2026
Das Bundeskabinett hat am 8.10.2025 eine Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen für 2026 um mehr als 5 % beschlossen, die Zustimmung des Bundesrates steht noch aus. Menschen mit höherem Einkommen müssen somit, sofern sie in das gesetzliche Sozialversicherungssystem einzahlen, auf einen höheren Anteil ihres Einkommens Beiträge abführen. Diese sehen wie folgt aus:
⇑| Sozialversicherungsrechengröße | Monat | Jahr |
| Bezugsgröße in der Sozialversicherung | 3.955 € | 47.460 € |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 6 SGB V (Versicherungspflichtgrenze) in der Kranken- und Pflegeversicherung |
6.450 € | 77.400 € |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 7 SGB V (Beitragsbemessungsgrenze) in der Kranken- und Pflegeversicherung |
5.812,50 € | 69.750 € |
| Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Renten- und Arbeitslosenversicherung | 8.450 € | 101.400 € |
| Beitragsbemessungsgrenze in der knappschaftlichen Rentenversicherung | 10.400 € | 124.800 € |
| vorläufiges Durchschnittsentgelt 2026 in der Rentenversicherung |
- | 51.944 € |
| (endgültiges) Durchschnittsentgelt 2024 in der Rentenversicherung |
- | 47.085 € |
Neue Sachbezugswerte 2026 für Unterkunft und Verpflegung
Unentgeltliche bzw. vergünstigte Mahlzeiten des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer sind als geldwerter Vorteil den Arbeitnehmern im Rahmen des Arbeitsverhältnisses zuzurechnen und zu versteuern.
Die Sachbezugswerte werden sich nach dem Referentenentwurf der Sozialversicherungsentgeltverordnung vom 8.10.2025 zum 1.1.2026 voraussichtlich erhöhen. Verabschiedet werden soll die Änderung nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe. Danach sehen die Sachbezugswerte wie folgt aus:
Diese Regelungen gelten auch für Mahlzeiten, die Arbeitnehmern während einer dienstlich veranlassten Auswärtstätigkeit oder bei doppelter Haushaltsführung zur Verfügung gestellt bzw. zugerechnet werden, wenn der Preis der Mahlzeit 60 € nicht übersteigt. Sonst stellt der Wert der Mahlzeit insgesamt einen geldwerten Vorteil dar.
Stellt der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer kostenlos oder vergünstigt eine Unterkunft zur Verfügung, wird wie folgt unterschieden, wobei bei Wohnungsüberlassung hiervon abweichend im Zweifel die ortsübliche Miete als Sachbezug anzusetzen ist:
* je nach Belegung
⇑Die Sachbezugswerte werden sich nach dem Referentenentwurf der Sozialversicherungsentgeltverordnung vom 8.10.2025 zum 1.1.2026 voraussichtlich erhöhen. Verabschiedet werden soll die Änderung nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe. Danach sehen die Sachbezugswerte wie folgt aus:
| Steuerfreier Sachbezug: Mahlzeiten bis 60 € (Inland) | ||
| 2025 | 2026 | |
| Frühstück | 2,30 €/Mahlzeit | 2,37 €/Mahlzeit |
| Mittag-/ Abendessen | 4,40 €/Mahlzeit | 4,57 €/Mahlzeit |
| Vollverpflegung | 11,10 €/Tag bzw. 333 €/Monat |
11,51 €/Tag bzw. 345 €/Monat |
Diese Regelungen gelten auch für Mahlzeiten, die Arbeitnehmern während einer dienstlich veranlassten Auswärtstätigkeit oder bei doppelter Haushaltsführung zur Verfügung gestellt bzw. zugerechnet werden, wenn der Preis der Mahlzeit 60 € nicht übersteigt. Sonst stellt der Wert der Mahlzeit insgesamt einen geldwerten Vorteil dar.
Stellt der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer kostenlos oder vergünstigt eine Unterkunft zur Verfügung, wird wie folgt unterschieden, wobei bei Wohnungsüberlassung hiervon abweichend im Zweifel die ortsübliche Miete als Sachbezug anzusetzen ist:
| Unterkunft des Arbeitgebers | ||
| 2025 | 2026 | |
| allg. Unterkunft Einzelnutzung durch Volljährige |
282 €/Monat | 285 €/Monat |
| Gemeinschaftsunterkunft Volljährige |
112,80 – 169,20 €/Monat* | 114 – 171 €/Monat* |
| Einzelnutzung durch Jugendliche / Azubis |
239,70 €/Monat | 242,25 €/Monat |
| Gemeinschaftsunterkunft Jugendliche/Azubis | 70,50 € – 126,90 €/Monat* | 71,25 – 128,25 €/Monat* |
E-Fahrzeuge am Arbeitsplatz aufladen
Eine weitere steuerliche Förderung zugunsten der Elektromobilität betrifft auch das Aufladen des E-Firmenwagens beim Arbeitnehmer zu Hause bzw. das Aufladen des privaten Elektro-PKW des Arbeitnehmers im Betrieb des Arbeitgebers. Hierbei werden sowohl reine Elektrofahrzeuge als auch Hybridfahrzeuge begünstigt.
Das kostenlose oder verbilligte Aufladen eines E-Fahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers oder das Überlassen eines Ladepunktes beim Arbeitnehmer zu Hause durch den Arbeitgeber ist, obwohl es sich um eine unentgeltliche Wertabgabe handelt und eigentlich einen steuerpflichtigen Vorgang darstellt, steuerfrei, wenn der Vorteil zusätzlich zum geschuldeten Lohn bzw. Gehalt gewährt wird. Es besteht dann auch Sozialversicherungsfreiheit.
Wer als Arbeitnehmer z. B. einen Firmenwagen fährt und seinen geldwerten Vorteil anhand der Fahrtenbuchmethode ermittelt, kann die Stromkosten herausrechnen, sodass der geldwerte Vorteil geringer ausfällt.
Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern eine betriebliche Wallbox nebst Zubehör und Einbau im Arbeitnehmerhaushalt zum Aufladen reiner Elektro- oder Hybridfahrzeuge überlassen. Sofern diese Eigentum des Arbeitgebers bleiben, ist diese Überlassung steuerfrei.
Sofern Zuschüsse zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für den Erwerb und die Nutzung einer Wallbox durch den Arbeitgeber gewährt werden, die Eigentum des Arbeitnehmers ist bzw. wird, ist eine Pauschalversteuerung von 25 % möglich.
Begünstigt ist auch das Aufladen privater reiner E- und Hybridfahrzeuge des Arbeitnehmers an Ladepunkten des Arbeitgebers beim Arbeitgeber.
Die Steuerfreiheit gilt zumindest bis zum Jahr 2030, sowohl für eigene Ladesäulen des Arbeitgebers als auch solche fremder Unternehmen auf dem Grundstück des Arbeitgebers, deren Kosten der Arbeitgeber trägt. Für vom Arbeitgeber angemietete Grundstücke gilt bei ansonsten gleicher Konstellation dieselbe Regelung.
Für Leiharbeitnehmer im Betrieb des Entleihers gilt die Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit bei privaten reinen E- und Hybridfahrzeugen ebenso.
Eigentlich müsste über die Aufladungen von auch zur privaten Nutzung überlassenen E-Dienstwagen, die beim Arbeitnehmer zuhause erfolgen, Aufzeichnungen angefertigt werden.
Zur Vereinfachung für die Erstattung des Auslagenersatzes durch den Arbeitgeber an den Arbeitnehmer bei der privaten Aufladung von Elektrodienstwagen gelten gemäß BMF-Schreiben folgende monatliche Pauschalen:
reines E-Fahrzeug ja 30 €
Hybridfahrzeug ja 15 €
reines E-Fahrzeug nein 70 €
Hybridfahrzeug nein 35 €
Mit Zahlung der Auslagenpauschale durch den Arbeitgeber sind sämtliche Ladekosten abgegolten. Sofern die tatsächlichen Kosten die o. g. Pauschalen übersteigen, können sie anhand von Belegen in tatsächlicher Höhe dem Arbeitnehmer als steuerfreier Auslagenersatz durch den Arbeitgeber erstattet werden. Erstattet der Arbeitgeber die Kosten des Ladestroms nicht, so vermindert sich der geldwerte Vorteil des Arbeitnehmers um die nachgewiesenen Kosten.
Die Erstattung von Ladestromkosten für ein privates E-Fahrzeug eines Arbeitnehmers an dessen privater Ladestation zuhause durch den Arbeitgeber ist steuer- und beitragsfrei nicht möglich, sondern stellt steuerpflichtigen Arbeitslohn dar.
Für dienstlich veranlasste Fahrten mit dem privaten E-Fahrzeug, welches an einer privaten E-Ladesäule aufgeladen wurde, bleibt es bei der für den Arbeitnehmer steuer- und beitragsfreien Erstattung der üblichen km-Pauschalen durch den Arbeitgeber.
Hinweis: Die unentgeltliche Wertabgabe muss durch den Arbeitgeber umsatzsteuerlich jedoch berücksichtigt werden.
⇑Das kostenlose oder verbilligte Aufladen eines E-Fahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers oder das Überlassen eines Ladepunktes beim Arbeitnehmer zu Hause durch den Arbeitgeber ist, obwohl es sich um eine unentgeltliche Wertabgabe handelt und eigentlich einen steuerpflichtigen Vorgang darstellt, steuerfrei, wenn der Vorteil zusätzlich zum geschuldeten Lohn bzw. Gehalt gewährt wird. Es besteht dann auch Sozialversicherungsfreiheit.
Wer als Arbeitnehmer z. B. einen Firmenwagen fährt und seinen geldwerten Vorteil anhand der Fahrtenbuchmethode ermittelt, kann die Stromkosten herausrechnen, sodass der geldwerte Vorteil geringer ausfällt.
Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern eine betriebliche Wallbox nebst Zubehör und Einbau im Arbeitnehmerhaushalt zum Aufladen reiner Elektro- oder Hybridfahrzeuge überlassen. Sofern diese Eigentum des Arbeitgebers bleiben, ist diese Überlassung steuerfrei.
Sofern Zuschüsse zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für den Erwerb und die Nutzung einer Wallbox durch den Arbeitgeber gewährt werden, die Eigentum des Arbeitnehmers ist bzw. wird, ist eine Pauschalversteuerung von 25 % möglich.
Begünstigt ist auch das Aufladen privater reiner E- und Hybridfahrzeuge des Arbeitnehmers an Ladepunkten des Arbeitgebers beim Arbeitgeber.
Die Steuerfreiheit gilt zumindest bis zum Jahr 2030, sowohl für eigene Ladesäulen des Arbeitgebers als auch solche fremder Unternehmen auf dem Grundstück des Arbeitgebers, deren Kosten der Arbeitgeber trägt. Für vom Arbeitgeber angemietete Grundstücke gilt bei ansonsten gleicher Konstellation dieselbe Regelung.
Für Leiharbeitnehmer im Betrieb des Entleihers gilt die Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit bei privaten reinen E- und Hybridfahrzeugen ebenso.
Eigentlich müsste über die Aufladungen von auch zur privaten Nutzung überlassenen E-Dienstwagen, die beim Arbeitnehmer zuhause erfolgen, Aufzeichnungen angefertigt werden.
Zur Vereinfachung für die Erstattung des Auslagenersatzes durch den Arbeitgeber an den Arbeitnehmer bei der privaten Aufladung von Elektrodienstwagen gelten gemäß BMF-Schreiben folgende monatliche Pauschalen:
| Fahrzeugtyp | Lademöglichkeit zusätzlich beim Arbeitgeber oder Stromtankkarte | Auslagenerstattung durch Arbeitgeber pauschal steuer- und beitragsfrei |
| reines E-Fahrzeug | ja | 30 € |
| Hybridfahrzeug | ja | 15 € |
| reines E-Fahrzeug | nein | 70 € |
| Hybridfahrzeug | nein | 35 € |
reines E-Fahrzeug ja 30 €
Hybridfahrzeug ja 15 €
reines E-Fahrzeug nein 70 €
Hybridfahrzeug nein 35 €
Mit Zahlung der Auslagenpauschale durch den Arbeitgeber sind sämtliche Ladekosten abgegolten. Sofern die tatsächlichen Kosten die o. g. Pauschalen übersteigen, können sie anhand von Belegen in tatsächlicher Höhe dem Arbeitnehmer als steuerfreier Auslagenersatz durch den Arbeitgeber erstattet werden. Erstattet der Arbeitgeber die Kosten des Ladestroms nicht, so vermindert sich der geldwerte Vorteil des Arbeitnehmers um die nachgewiesenen Kosten.
Die Erstattung von Ladestromkosten für ein privates E-Fahrzeug eines Arbeitnehmers an dessen privater Ladestation zuhause durch den Arbeitgeber ist steuer- und beitragsfrei nicht möglich, sondern stellt steuerpflichtigen Arbeitslohn dar.
Für dienstlich veranlasste Fahrten mit dem privaten E-Fahrzeug, welches an einer privaten E-Ladesäule aufgeladen wurde, bleibt es bei der für den Arbeitnehmer steuer- und beitragsfreien Erstattung der üblichen km-Pauschalen durch den Arbeitgeber.
Hinweis: Die unentgeltliche Wertabgabe muss durch den Arbeitgeber umsatzsteuerlich jedoch berücksichtigt werden.
Anforderung von Unterlagen durch das Finanzamt zulässig
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu befinden, ob die Anforderung von Mietverträgen, Nebenkostenabrechnungen, Mieterhöhungsschreiben, Belegen über Erhaltungsaufwand und ähnlichen Unterlagen durch das Finanzamt bei einem Vermieter von Wohnraum zulässig ist bzw. der Vermieter die Vorlage ohne Zustimmung des Mieters verweigern darf.
Eine Vermieterin hatte die Herausgabe unter Hinweis auf die fehlende Einwilligung des Mieters und nach ihrer Auffassung daraus folgenden Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) abgelehnt. Das Finanzamt hatte die Anforderung der Unterlagen mit steuerlicher Relevanz begründet.
Der BFH entschied, dass eine Anforderung von Unterlagen zum Mietverhältnis durch das Finanzamt zwar datenschutzrechtlich relevant sei, ein Vermieter allerdings nach der Abgabenordnung zur Vorlage bei steuerlicher Relevanz verpflichtet sei, in der Regel vollständig und ungeschwärzt. Das Finanzamt müsse begründen, warum eine steuerliche Relevanz vorliege und die angeforderten Unterlagen genau bezeichnen. In diesem Fall wiege das Interesse des Finanzamtes höher als das mögliche Datenschutzinteresse eines Mieters.
Vermieter sollten demnach immer nur die konkret bezeichneten Unterlagen herausgeben, um nicht mit der DSGVO in Konflikt zu geraten.
Wichtige Unterlagen, die angefordert werden können, sind:
Mietvertrag und Mieterhöhungen
Nebenkostenabrechnungen
Belege zu Instandhaltungs- und Erhaltungsaufwand
Belege über die Mieteinnahmen, z. B. Kontoauszüge
Eine Anforderung von Unterlagen, die steuerlich nicht relevant sind, ist nicht zulässig. Das Finanzamt muss verhältnismäßig vorgehen und darf keine Ausforschung anhand beliebiger Unterlagen betreiben. Herausgaben von derart angeforderten Unterlagen sind daher nicht notwendig.
⇑Eine Vermieterin hatte die Herausgabe unter Hinweis auf die fehlende Einwilligung des Mieters und nach ihrer Auffassung daraus folgenden Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) abgelehnt. Das Finanzamt hatte die Anforderung der Unterlagen mit steuerlicher Relevanz begründet.
Der BFH entschied, dass eine Anforderung von Unterlagen zum Mietverhältnis durch das Finanzamt zwar datenschutzrechtlich relevant sei, ein Vermieter allerdings nach der Abgabenordnung zur Vorlage bei steuerlicher Relevanz verpflichtet sei, in der Regel vollständig und ungeschwärzt. Das Finanzamt müsse begründen, warum eine steuerliche Relevanz vorliege und die angeforderten Unterlagen genau bezeichnen. In diesem Fall wiege das Interesse des Finanzamtes höher als das mögliche Datenschutzinteresse eines Mieters.
Vermieter sollten demnach immer nur die konkret bezeichneten Unterlagen herausgeben, um nicht mit der DSGVO in Konflikt zu geraten.
Wichtige Unterlagen, die angefordert werden können, sind:
Mietvertrag und Mieterhöhungen
Nebenkostenabrechnungen
Belege zu Instandhaltungs- und Erhaltungsaufwand
Belege über die Mieteinnahmen, z. B. Kontoauszüge
Eine Anforderung von Unterlagen, die steuerlich nicht relevant sind, ist nicht zulässig. Das Finanzamt muss verhältnismäßig vorgehen und darf keine Ausforschung anhand beliebiger Unterlagen betreiben. Herausgaben von derart angeforderten Unterlagen sind daher nicht notwendig.
Geschenkt: Einlage des Familienheims in eine GbR
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu entscheiden, ob die Einbringung eines Familien-heims durch einen Alleineigentümer-Ehegatten in eine GbR, an der beide Ehegatten je zur Hälfte beteiligt sind, zur Festsetzung von Schenkungsteuer gegenüber dem anderen, beschenkten Ehegat-ten führt. Im notariellen Vertrag wurde die Einbringung als unentgeltliche, ehebedingte Zuwen-dung der Ehefrau an den Ehemann, den Kläger, bezeichnet. Beide Eheleute wurden als Gesell-schafter und Eigentümer des Grundstücks in das Grundbuch eingetragen.
Das Finanzamt (FA) hatte, obwohl unstreitig war, dass es sich um ein Familienheim handelte, Schenkungsteuer gegen den Kläger als Begünstigten festgesetzt. Die Voraussetzungen für das Bestehen eines Familienheims sind u. a., dass die Wohnung den Lebensmittelpunkt darstellen muss, Nutzung durch den Schenker bis zur Schenkung und anschließende Nutzung durch den Beschenkten. Zur Begründung führte das FA an, dass wegen der Übertragung der Immobilie auf die GbR die Steuerfreiheit eines Familienheims nicht anwendbar sei. Die Hälfte sei dem Kläger zuzurechnen und Schenkungsteuer zu erheben. Der Einspruch blieb erfolglos. Das erstinstanzliche Finanzgericht gab der Klage statt und änderte die Schenkungsteuer auf 0 € mit der Begründung, dass auch der Erwerb von Gesamthandseigentum steuerfrei als Familienheim möglich sei. Der BFH sah die Revision des FA als unbegründet an und wies sie zurück.
Nach Auffassung des BFH ist bei einer GbR der einzelne Gesellschafter Steuerschuldner und nicht die Gesamthandgemeinschaft, obwohl die GbR teilrechts- und eintragungsfähig ist. Demnach ist ein bebautes Grundstück auch ein Familienheim, welches den inneren Kern der Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft eines Paares betrifft. Dieses hat der Gesetzgeber ausdrücklich privilegiert und steuerfrei gestellt.
⇑Das Finanzamt (FA) hatte, obwohl unstreitig war, dass es sich um ein Familienheim handelte, Schenkungsteuer gegen den Kläger als Begünstigten festgesetzt. Die Voraussetzungen für das Bestehen eines Familienheims sind u. a., dass die Wohnung den Lebensmittelpunkt darstellen muss, Nutzung durch den Schenker bis zur Schenkung und anschließende Nutzung durch den Beschenkten. Zur Begründung führte das FA an, dass wegen der Übertragung der Immobilie auf die GbR die Steuerfreiheit eines Familienheims nicht anwendbar sei. Die Hälfte sei dem Kläger zuzurechnen und Schenkungsteuer zu erheben. Der Einspruch blieb erfolglos. Das erstinstanzliche Finanzgericht gab der Klage statt und änderte die Schenkungsteuer auf 0 € mit der Begründung, dass auch der Erwerb von Gesamthandseigentum steuerfrei als Familienheim möglich sei. Der BFH sah die Revision des FA als unbegründet an und wies sie zurück.
Nach Auffassung des BFH ist bei einer GbR der einzelne Gesellschafter Steuerschuldner und nicht die Gesamthandgemeinschaft, obwohl die GbR teilrechts- und eintragungsfähig ist. Demnach ist ein bebautes Grundstück auch ein Familienheim, welches den inneren Kern der Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft eines Paares betrifft. Dieses hat der Gesetzgeber ausdrücklich privilegiert und steuerfrei gestellt.
Workation: Was Arbeitgeber und Arbeitnehmer beachten müssen
Ermöglichen in Deutschland ansässige Unternehmen ihrer Belegschaft das kurzfristige mobile Arbeiten aus dem Ausland, auch Workation genannt, ist dies für viele Jobsuchende eines von mehreren Kriterien, sich für oder gegen eine Arbeitsaufnahme in dem betreffenden Unternehmen oder für einen Jobwechsel zu entscheiden. Mittlerweile erwarten laut einer Workation-Studie deutlich mehr als die Hälfte der Beschäftigten von ihren Arbeitgebern, dass mobiles Arbeiten nicht nur im Inland, sondern auch aus dem Ausland ermöglicht wird.
Gleichwohl sind sowohl die Unternehmen als auch die Beschäftigten oft nicht hinreichend über die rechtlichen und steuerlichen Voraussetzungen und Folgen informiert. In den Arbeitsverträgen und Zusatzvereinbarungen finden sich häufig keine rechtssicheren Vereinbarungen.
Deutlich definierte Regelungen sind allein aus Haftungsgründen sehr wichtig. Die Unternehmen sollten daher steuer-, arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Regelungen vorab prüfen bzw. prüfen lassen. Workation ist deutlich abzugrenzen von einer dauerhaften Tätigkeit im Ausland für das Unternehmen, aber auch die Arbeit in einer ausländischen Niederlassung eines deutschen Unternehmens stellt keine Workation dar.
Folgende Punkte sollten vorab geklärt bzw. vertraglich vereinbart werden:
Achtung: Wer ohne Arbeitserlaubnis arbeitet, gilt als illegal beschäftigt, kann ggf. ausgewiesen und mit Einreiseverboten belegt werden. Für den Arbeitgeber kann ein derartiges Vorgehen zu einer Gewerbeuntersagung mit hohen Bußgeldern führen.
Die Beachtung der sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen und Folgen sind ebenfalls wichtig.
Wenn ein Arbeitgeber einer Workation im EU-Ausland zustimmt, gilt dieser Umstand sozialversicherungsrechtlich als Entsendung. Der Arbeitgeber verpflichtet sich damit, für das Bestehen eines Krankenversicherungsschutzes seiner Mitarbeiter und der mitreisenden Familienangehörigen zu haften bzw. dafür Sorge zu tragen, dass dieser besteht.
Die vorübergehende Entsendung eines Mitarbeiters aus Deutschland im Auftrag des inländischen Unternehmens in das europäische Ausland muss im Voraus zeitlich befristet sein. Das Entgelt muss in Deutschland abgerechnet werden. Eine Auslandsentsendung liegt nicht vor, wenn die entsandte Person im Ausland lebt und von einem deutschen Unternehmen für eine Tätigkeit in ihrem Heimatstaat oder einem anderen Land eingestellt wird. Die Person darf vor der Tätigkeit nicht in Deutschland beschäftigt gewesen sein oder zuvor in Deutschland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt gehabt haben.
⇑Gleichwohl sind sowohl die Unternehmen als auch die Beschäftigten oft nicht hinreichend über die rechtlichen und steuerlichen Voraussetzungen und Folgen informiert. In den Arbeitsverträgen und Zusatzvereinbarungen finden sich häufig keine rechtssicheren Vereinbarungen.
Deutlich definierte Regelungen sind allein aus Haftungsgründen sehr wichtig. Die Unternehmen sollten daher steuer-, arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Regelungen vorab prüfen bzw. prüfen lassen. Workation ist deutlich abzugrenzen von einer dauerhaften Tätigkeit im Ausland für das Unternehmen, aber auch die Arbeit in einer ausländischen Niederlassung eines deutschen Unternehmens stellt keine Workation dar.
Folgende Punkte sollten vorab geklärt bzw. vertraglich vereinbart werden:
- Innerbetriebliche Regelungen sollten klarstellen, welche Beschäftigungsgruppen das Workation-Angebot nutzen können.
- Bei einer vorübergehenden Workation bis zu 4 Wochen gilt deutsches Arbeitsrecht, Feiertage am Arbeitsort gelten auch für den Beschäftigten.
- Bei einer länger als 4 Wochen andauernden Workation muss das Unternehmen den Beschäftigten einen schriftlichen Nachweis hierüber sowie weitere Angaben aushändigen, z. B. über die Dauer des Aufenthalts und die Währung, in der das Arbeitsentgelt gezahlt wird (Nachweisgesetz).
- Bei einer mehr als 6 Monate andauernden Workation gilt das Arbeitsrecht des Workation-Landes im Hinblick auf Entlohnung, Kündigungsfristen, Arbeitszeiten und Urlaubsansprüche.
- Längere Workation in Nicht-EU-Ländern führen i. d. R. zur Notwendigkeit eines Visums, ein Touristenvisum ist nicht ausreichend. Ggf. ist ein Arbeits- oder spezielles Workationsvisum zu beantragen, welches es in einigen Ländern bereits gibt.
Achtung: Wer ohne Arbeitserlaubnis arbeitet, gilt als illegal beschäftigt, kann ggf. ausgewiesen und mit Einreiseverboten belegt werden. Für den Arbeitgeber kann ein derartiges Vorgehen zu einer Gewerbeuntersagung mit hohen Bußgeldern führen.
- Innerhalb der EU, der EWR und der Schweiz können Beschäftigte sich zu Arbeitszwecken uneingeschränkt aufhalten. Ein Visum wird nicht benötigt. Allerdings sind in den meisten Ländern Melde- oder Registrierpflichten zu beachten.
- Wer max. 183 Tage im Jahr im Ausland arbeitet, bleibt in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, bei längerem Aufenthalt entsteht die Steuerpflicht im Ausland.
- Dauert eine Workation länger als 4 Wochen, muss insbesondere der Arbeitgeber arbeits- und steuerrechtliche Folgen beachten. Hierüber sollte der Arbeitgeber sich auch immer selbstständig informieren.
Die Beachtung der sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen und Folgen sind ebenfalls wichtig.
- Bei einer Workation im Drittland - außerhalb der EU - muss geprüft werden, ob zwischen Deutschland und dem jeweiligen Staat ein Sozialversicherungsabkommen besteht. Diese Information sollte rechtzeitig eingeholt werden. Beratung bzw. Rücksprache mit einer Fachkraft in Auslandsentsendungsfragen ist hier hilfreich.
- Bei einer Workation innerhalb der EU, EWR oder Schweiz benötigt der Arbeitnehmer eine sog. A1-Bescheinigung, die dem Nachweis der Versicherungszugehörigkeit dient und elektronisch vom Arbeitgeber oder Arbeitnehmer beantragt werden kann.
- Zu beachten ist, dass auch Grenzgänger seit 2025 eine solche A1-Bescheinigung benötigen, selbst wenn keine Workation stattfindet.
Wenn ein Arbeitgeber einer Workation im EU-Ausland zustimmt, gilt dieser Umstand sozialversicherungsrechtlich als Entsendung. Der Arbeitgeber verpflichtet sich damit, für das Bestehen eines Krankenversicherungsschutzes seiner Mitarbeiter und der mitreisenden Familienangehörigen zu haften bzw. dafür Sorge zu tragen, dass dieser besteht.
Die vorübergehende Entsendung eines Mitarbeiters aus Deutschland im Auftrag des inländischen Unternehmens in das europäische Ausland muss im Voraus zeitlich befristet sein. Das Entgelt muss in Deutschland abgerechnet werden. Eine Auslandsentsendung liegt nicht vor, wenn die entsandte Person im Ausland lebt und von einem deutschen Unternehmen für eine Tätigkeit in ihrem Heimatstaat oder einem anderen Land eingestellt wird. Die Person darf vor der Tätigkeit nicht in Deutschland beschäftigt gewesen sein oder zuvor in Deutschland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt gehabt haben.
Bundesfinanzhof entscheidet zur Grundsteuer im „Bundesmodell“
Der Bundesfinanzhof wird am 10.12.2025 (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) in drei Verfahren öffentlich seine Entscheidungen verkünden.
Dies ist insbesondere für Grundstückseigentümer in den Bundesländern interessant, welche die Grundsteuerreform nach dem Bundesmodell umgesetzt haben. Dies sind die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Das Saarland und Sachsen nutzen ebenfalls die Bundesregelungen mit Abweichungen bei der Steuermesszahl.
Das Bundesmodell stellt den Grundstückwert für Wohngrundstücke anhand der Grundstücks- und Wohnfläche sowie des Bodenrichtwerts, Gebäudeart und Baujahr fest. Die drei Verfahren, die zur Entscheidung anstehen, haben gemeinsam, dass die Verfassungsmäßigkeit des für Grundsteuerzwecke pauschalierten Ertragswertverfahrens streitig ist.
Das pauschalierte Ertragswertverfahren findet Anwendung auf Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke und Eigentumswohnungen. Auch für die Erbschaft- und Schenkungsteuer wird teilweise das Ertragswertverfahren angewendet, allerdings im Gegensatz zur Grundsteuer wird dort z. B. nach den tatsächlichen Nettomieten bewertet und nicht nach landeseinheitlich geltenden Nettokaltmieten. Eine Unterscheidung gibt es bei der Grundsteuer lediglich nach Gebäudeart, Baujahr und Wohnflächengruppe, die über Zu- und Abschläge zum Ausdruck gebracht werden. So findet z. B. auch keine Unterscheidung der Mietniveaustufen nach Stadtlage oder ländlicher Lage statt.
Die Frage, die der BFH zu beantworten haben wird, ist, ob es mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist, in einer Vielzahl von Grundsteuerverfahren mit einem grob vereinfachten Verfahrensansatz wie durch Gutachterausschüsse festgestellte Bodenrichtwerte und pauschalierte Nettokaltmieten den Wert eines Grundstücks bzw. einer Wohneinheit zu bestimmen.
Es sind derzeit ca. 2.000 Klageverfahren zu unterschiedlichen Grundsteuermodellen rechtshängig, beim BFH sind es 15 Verfahren.
⇑Dies ist insbesondere für Grundstückseigentümer in den Bundesländern interessant, welche die Grundsteuerreform nach dem Bundesmodell umgesetzt haben. Dies sind die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Das Saarland und Sachsen nutzen ebenfalls die Bundesregelungen mit Abweichungen bei der Steuermesszahl.
Das Bundesmodell stellt den Grundstückwert für Wohngrundstücke anhand der Grundstücks- und Wohnfläche sowie des Bodenrichtwerts, Gebäudeart und Baujahr fest. Die drei Verfahren, die zur Entscheidung anstehen, haben gemeinsam, dass die Verfassungsmäßigkeit des für Grundsteuerzwecke pauschalierten Ertragswertverfahrens streitig ist.
Das pauschalierte Ertragswertverfahren findet Anwendung auf Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke und Eigentumswohnungen. Auch für die Erbschaft- und Schenkungsteuer wird teilweise das Ertragswertverfahren angewendet, allerdings im Gegensatz zur Grundsteuer wird dort z. B. nach den tatsächlichen Nettomieten bewertet und nicht nach landeseinheitlich geltenden Nettokaltmieten. Eine Unterscheidung gibt es bei der Grundsteuer lediglich nach Gebäudeart, Baujahr und Wohnflächengruppe, die über Zu- und Abschläge zum Ausdruck gebracht werden. So findet z. B. auch keine Unterscheidung der Mietniveaustufen nach Stadtlage oder ländlicher Lage statt.
Die Frage, die der BFH zu beantworten haben wird, ist, ob es mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist, in einer Vielzahl von Grundsteuerverfahren mit einem grob vereinfachten Verfahrensansatz wie durch Gutachterausschüsse festgestellte Bodenrichtwerte und pauschalierte Nettokaltmieten den Wert eines Grundstücks bzw. einer Wohneinheit zu bestimmen.
Es sind derzeit ca. 2.000 Klageverfahren zu unterschiedlichen Grundsteuermodellen rechtshängig, beim BFH sind es 15 Verfahren.
Terminsache: Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 10.2.2026
Unternehmen, die ihre monatlichen Umsatzsteuervoranmeldungen nicht zum 10. des Folgemonats einreichen bzw. -vorauszahlungen nicht bis zum 13. des Folgemonats leisten möchten, können bis zum 10.2.2026 für das Jahr 2026 einen Antrag auf eine sog. Dauerfristverlängerung stellen. Es ist eine Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung i. H. v. einem Elftel der Umsatzsteuerzahllast des Vorjahres an das Finanzamt zu leisten. Die Umsatzsteuervoranmeldungen bzw. -zahlungen dürfen jeweils einen Monat später abgegeben bzw. gezahlt werden. Quartalszahler müssen keine Sondervorauszahlungen leisten. Die Höhe der jeweiligen Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung kann ab dem 1.1.2026 über ELSTER abgerufen werden. Die Sondervorauszahlung wird mit der Umsatzsteuervorauszahlung für Dezember verrechnet.
Achtung: Seit dem 9.10.2025 sind Banken zur Verhinderung von Online-Fehlüberweisungen und Betrug verpflichtet, den Empfängernamen mit der IBAN abzugleichen. Stimmen Empfängername und IBAN nicht überein, wird die Überweisung zunächst nicht ausgeführt. Der Kunde wird auf einen abweichenden Kontoinhaber hingewiesen und kann aktiv auswählen. Mit einer Bestätigung durch den Kunden haftet die Bank nicht mehr für Fehlüberweisungen. Dieses gilt insbesondere auch bei Echtzeitüberweisungen. Bei Papierüberweisungen gilt diese Regelung nicht.
Auf Steuerbescheiden stehen nicht immer die Empfängerangaben, sondern mitunter lediglich die IBAN. Es gilt daher, rechtzeitig den Abgleich vorzunehmen, um Zahlungsfristen nicht zu verpassen.
⇑Achtung: Seit dem 9.10.2025 sind Banken zur Verhinderung von Online-Fehlüberweisungen und Betrug verpflichtet, den Empfängernamen mit der IBAN abzugleichen. Stimmen Empfängername und IBAN nicht überein, wird die Überweisung zunächst nicht ausgeführt. Der Kunde wird auf einen abweichenden Kontoinhaber hingewiesen und kann aktiv auswählen. Mit einer Bestätigung durch den Kunden haftet die Bank nicht mehr für Fehlüberweisungen. Dieses gilt insbesondere auch bei Echtzeitüberweisungen. Bei Papierüberweisungen gilt diese Regelung nicht.
Auf Steuerbescheiden stehen nicht immer die Empfängerangaben, sondern mitunter lediglich die IBAN. Es gilt daher, rechtzeitig den Abgleich vorzunehmen, um Zahlungsfristen nicht zu verpassen.
Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge wird verlängert
Das Bundeskabinett hat am 15.10.2025 beschlossen, dass die KFZ-Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 2035 verlängert werden soll. Die erste Lesung im Bundestag hat am 14.11.2025 stattgefunden. Der Gesetzentwurf wurde zur weiteren Debatte in die Fachausschüsse verwiesen.
Die Steuerbefreiung soll für Fahrzeuge gelten, die spätestens bis zum 31.12.2030 erstmalig für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen werden. Die Steuerbefreiung gilt bis zu 10 Jahre, längstens jedoch bis zum 31.12.2035.
Die Stellungnahme des Bundesrates steht noch aus.
Ohne eines Änderung des Gesetzes wären nur noch reine Elektrofahrzeuge von der KFZ-Steuer befreit, die vor dem 1.1.2026 erstmalig zugelassen werden.
⇑Die Steuerbefreiung soll für Fahrzeuge gelten, die spätestens bis zum 31.12.2030 erstmalig für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen werden. Die Steuerbefreiung gilt bis zu 10 Jahre, längstens jedoch bis zum 31.12.2035.
Die Stellungnahme des Bundesrates steht noch aus.
Ohne eines Änderung des Gesetzes wären nur noch reine Elektrofahrzeuge von der KFZ-Steuer befreit, die vor dem 1.1.2026 erstmalig zugelassen werden.
Keine erste Tätigkeitsstätte bei unbefristetem Leiharbeitsverhältnis
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass dem unbefristet beschäftigten Arbeitnehmer im Rahmen eines Leiharbeitsverhältnisses üblicherweise keine erste Tätigkeitsstätte zugeordnet werden kann, auch dann nicht, wenn er dauerhaft im Rahmen des Leiharbeitsverhältnisses in einem Betrieb eingesetzt wird.
Der im Rahmen eines zunächst befristeten und später unbefristeten Leiharbeitsverhältnisses beschäftigte Arbeitnehmer wurde langfristig in dem gleichen Betrieb eingesetzt.
Im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung machte er die entstandenen Fahrtkosten zu seinem Einsatzort nicht als Werbungskosten geltend, sondern mit den höheren, für ihn vorteilhafteren Fahrtkostenpauschalen als Auswärtstätigkeit.
Dies hat das Finanzamt abgelehnt und lediglich den Werbungskostenabzug zugelassen. Der BFH hat sich jedoch der Auffassung des Klägers angeschlossen.
Zur Begründung führte der BFH aus, dass die Tätigkeit eines Leiharbeitnehmers aufgrund der Vereinbarung zwischen Entleiher und Verleiher in der Regel lediglich eine vorübergehende und keine dauerhafte Tätigkeit im Betrieb des Entleihers darstellt. Darüber hinaus gelte seit April 2017 die Regelung, dass ein Leiharbeitnehmer nicht länger als 18 Monate im gleichen Betrieb beschäftigt werden dürfe, was in der Regelung für eine nicht dauerhafte Beschäftigung im gleichen Betrieb spreche. Grundsätzlich ist bei einem Leiharbeitnehmer davon auszugehen, dass ein vorübergehender und kein dauerhafter Einsatzort gegeben sei.
Da der Werbungskostenabzug bei einer dauerhaften ersten Tätigkeitsstätte erfolgt, bei vorübergehender Tätigkeit mit üblicherweise wechselnden Tätigkeitsstätten die höheren Fahrtkostenpauschalen für Auswärtstätigkeit in Abzug gebracht werden können, gab der BFH der Klage statt.
⇑Der im Rahmen eines zunächst befristeten und später unbefristeten Leiharbeitsverhältnisses beschäftigte Arbeitnehmer wurde langfristig in dem gleichen Betrieb eingesetzt.
Im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung machte er die entstandenen Fahrtkosten zu seinem Einsatzort nicht als Werbungskosten geltend, sondern mit den höheren, für ihn vorteilhafteren Fahrtkostenpauschalen als Auswärtstätigkeit.
Dies hat das Finanzamt abgelehnt und lediglich den Werbungskostenabzug zugelassen. Der BFH hat sich jedoch der Auffassung des Klägers angeschlossen.
Zur Begründung führte der BFH aus, dass die Tätigkeit eines Leiharbeitnehmers aufgrund der Vereinbarung zwischen Entleiher und Verleiher in der Regel lediglich eine vorübergehende und keine dauerhafte Tätigkeit im Betrieb des Entleihers darstellt. Darüber hinaus gelte seit April 2017 die Regelung, dass ein Leiharbeitnehmer nicht länger als 18 Monate im gleichen Betrieb beschäftigt werden dürfe, was in der Regelung für eine nicht dauerhafte Beschäftigung im gleichen Betrieb spreche. Grundsätzlich ist bei einem Leiharbeitnehmer davon auszugehen, dass ein vorübergehender und kein dauerhafter Einsatzort gegeben sei.
Da der Werbungskostenabzug bei einer dauerhaften ersten Tätigkeitsstätte erfolgt, bei vorübergehender Tätigkeit mit üblicherweise wechselnden Tätigkeitsstätten die höheren Fahrtkostenpauschalen für Auswärtstätigkeit in Abzug gebracht werden können, gab der BFH der Klage statt.
Sonderabschreibung: Neuer Ersatzbau = Neubau?
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat Ende Oktober 2025 ein bereits seit längerer Zeit erwartetes Urteil vom 12.8.2025 zur Sonderabschreibungsmöglichkeit von Mietwohnungsneubau veröffentlicht.
Im Klageverfahren ging es um einen ersten Förderzeitraum, für den die Wohnungsherstellung durch Bauantrag oder Bauanzeige nach dem 31.8.2018, aber vor dem 1.1.2022 begann. Aktuell gibt es einen zweiten Förderzeitraum für Bauanträge oder Bauanzeigen über Wohnungsherstellungen, die nach dem 31.12.2022, aber vor dem 1.10.2029 begannen.
Die Kläger hatten im ersten Förderzeitraum ein vermietetes, nutzbares Einfamilienhaus nach Kündigung und Auszug der Mieter abgerissen, weil eine behördliche Aufforderung zur Sanierung der Abwasserrohre erfolgt war. Auf dem Grundstück wurde ebenfalls wieder ein Einfamilienhaus errichtet, über welches auch ein Mietvertrag mit Mietern abgeschlossen wurde. Das Finanzamt wollte die von den Klägern geltend gemachte Sonderabschreibung nicht als Werbungskosten anerkennen, da es sich zwar um einen Neubau handelte, aber kein zusätzlicher Wohnraum geschaffen worden sei. Abriss und Neubau erfolgten innerhalb eines Zeitraumes von ca. 1,5 Jahren.
Weder die Gesetzesbegründung noch die Finanzverwaltung äußerten sich im Vorfeld bzw. im Nachgang des Gesetzgebungsverfahrens dazu, ob die Formulierung „neue, bisher nicht vorhandene Wohnung hergestellt“ so zu verstehen sei, dass ein neuer Ersatzbau, der keinen zusätzlichen Wohnraum schaffe, auch nicht förderfähig sei oder ob eine Rückschau auf das abgerissene Gebäude relevant sei, womöglich durch einen Wohnflächenvergleich und Gebäudeart vor und nach dem Abriss.
Sowohl das erstinstanzliche Finanzgericht Köln als auch der BFH haben die Fördervoraussetzungen für die Sonderabschreibung als nicht gegeben angesehen.
Der BFH stellte in seiner Entscheidung im Wesentlichen darauf ab, dass ein Ersetzen vorhandener Wohnungen durch einen gleichartigen Neubau keine „neue, bisher nicht vorhandene Wohnung“ darstelle. Dies könne allerdings anders sein, wenn der Abriss und der Neubau einer Wohnung nicht im zeitlichen Zusammenhang stehen wie im zu entscheidenden Fall.
Sinn und Zweck der Norm und der Förderung sei es, eine Vermehrung von Wohnraum zu erreichen und diesen nicht lediglich zu ersetzen. Mit der Förderung durch die Sonderabschreibung sollte der Wohnungsknappheit entgegengewirkt werden.
Im aktuellen zweiten Förderzeitraum, über den im Urteil nicht zu entscheiden war, heißt es nur noch „neue“ Wohnung mit den Kriterien des „Effizienzhaus 40“ mit Nachhaltigkeitsfaktor.
Der BFH hat in seiner Entscheidung allerdings bereits anklingen lassen, dass auch hier die gleichen Parameter gelten könnten.
Insoweit dürfte, wenn weder die Finanzverwaltung noch der Gesetzgeber klärend eingreifen, mit einer Vielzahl an Klageverfahren zu rechnen sein.
Betroffene Steuerpflichtige sollten sich umgehend steuerlich beraten lassen, wenn das zuständige Finanzamt die Sonderabschreibung nicht anerkannt hat.
⇑Im Klageverfahren ging es um einen ersten Förderzeitraum, für den die Wohnungsherstellung durch Bauantrag oder Bauanzeige nach dem 31.8.2018, aber vor dem 1.1.2022 begann. Aktuell gibt es einen zweiten Förderzeitraum für Bauanträge oder Bauanzeigen über Wohnungsherstellungen, die nach dem 31.12.2022, aber vor dem 1.10.2029 begannen.
Die Kläger hatten im ersten Förderzeitraum ein vermietetes, nutzbares Einfamilienhaus nach Kündigung und Auszug der Mieter abgerissen, weil eine behördliche Aufforderung zur Sanierung der Abwasserrohre erfolgt war. Auf dem Grundstück wurde ebenfalls wieder ein Einfamilienhaus errichtet, über welches auch ein Mietvertrag mit Mietern abgeschlossen wurde. Das Finanzamt wollte die von den Klägern geltend gemachte Sonderabschreibung nicht als Werbungskosten anerkennen, da es sich zwar um einen Neubau handelte, aber kein zusätzlicher Wohnraum geschaffen worden sei. Abriss und Neubau erfolgten innerhalb eines Zeitraumes von ca. 1,5 Jahren.
Weder die Gesetzesbegründung noch die Finanzverwaltung äußerten sich im Vorfeld bzw. im Nachgang des Gesetzgebungsverfahrens dazu, ob die Formulierung „neue, bisher nicht vorhandene Wohnung hergestellt“ so zu verstehen sei, dass ein neuer Ersatzbau, der keinen zusätzlichen Wohnraum schaffe, auch nicht förderfähig sei oder ob eine Rückschau auf das abgerissene Gebäude relevant sei, womöglich durch einen Wohnflächenvergleich und Gebäudeart vor und nach dem Abriss.
Sowohl das erstinstanzliche Finanzgericht Köln als auch der BFH haben die Fördervoraussetzungen für die Sonderabschreibung als nicht gegeben angesehen.
Der BFH stellte in seiner Entscheidung im Wesentlichen darauf ab, dass ein Ersetzen vorhandener Wohnungen durch einen gleichartigen Neubau keine „neue, bisher nicht vorhandene Wohnung“ darstelle. Dies könne allerdings anders sein, wenn der Abriss und der Neubau einer Wohnung nicht im zeitlichen Zusammenhang stehen wie im zu entscheidenden Fall.
Sinn und Zweck der Norm und der Förderung sei es, eine Vermehrung von Wohnraum zu erreichen und diesen nicht lediglich zu ersetzen. Mit der Förderung durch die Sonderabschreibung sollte der Wohnungsknappheit entgegengewirkt werden.
Im aktuellen zweiten Förderzeitraum, über den im Urteil nicht zu entscheiden war, heißt es nur noch „neue“ Wohnung mit den Kriterien des „Effizienzhaus 40“ mit Nachhaltigkeitsfaktor.
Der BFH hat in seiner Entscheidung allerdings bereits anklingen lassen, dass auch hier die gleichen Parameter gelten könnten.
Insoweit dürfte, wenn weder die Finanzverwaltung noch der Gesetzgeber klärend eingreifen, mit einer Vielzahl an Klageverfahren zu rechnen sein.
Betroffene Steuerpflichtige sollten sich umgehend steuerlich beraten lassen, wenn das zuständige Finanzamt die Sonderabschreibung nicht anerkannt hat.
Deutschlandticket 2026
Das Deutschlandticket soll auch in den Jahren 2026 – 2030 erhalten bleiben. Der aktuelle Bezugspreis von 58 € in 2025 soll lt. Vereinbarung der Verkehrsminister der Bundesländer in 2026 auf 63 € monatlich steigen. Auch im Jahr 2026 können Zuschüsse zum Deutschlandticket durch den Arbeitgeber steuer- und sozialversicherungsfrei zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden. Der Zuschuss ist auf die Höhe der Aufwendungen des Arbeitnehmers begrenzt.
⇑Beitragsbemessungsgrenzen steigen ab 2026
Das Bundeskabinett hat am 8.10.2025 eine Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen für 2026 um mehr als 5 % beschlossen, die Zustimmung des Bundesrates steht noch aus. Menschen mit höherem Einkommen müssen somit, sofern sie in das gesetzliche Sozialversicherungssystem einzahlen, auf einen höheren Anteil ihres Einkommens Beiträge abführen. Diese sehen wie folgt aus:
⇑| Sozialversicherungsrechengröße | Monat | Jahr |
| Bezugsgröße in der Sozialversicherung | 3.955 € | 47.460 € |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 6 SGB V (Versicherungspflichtgrenze) in der Kranken- und Pflegeversicherung |
6.450 € | 77.400 € |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 7 SGB V (Beitragsbemessungsgrenze) in der Kranken- und Pflegeversicherung |
5.812,50 € | 69.750 € |
| Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Renten- und Arbeitslosenversicherung | 8.450 € | 101.400 € |
| Beitragsbemessungsgrenze in der knappschaftlichen Rentenversicherung | 10.400 € | 124.800 € |
| vorläufiges Durchschnittsentgelt 2026 in der Rentenversicherung |
- | 51.944 € |
| (endgültiges) Durchschnittsentgelt 2024 in der Rentenversicherung |
- | 47.085 € |
Anforderung von Unterlagen durch das Finanzamt zulässig
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu befinden, ob die Anforderung von Mietverträgen, Nebenkostenabrechnungen, Mieterhöhungsschreiben, Belegen über Erhaltungsaufwand und ähnlichen Unterlagen durch das Finanzamt bei einem Vermieter von Wohnraum zulässig ist bzw. der Vermieter die Vorlage ohne Zustimmung des Mieters verweigern darf.
Eine Vermieterin hatte die Herausgabe unter Hinweis auf die fehlende Einwilligung des Mieters und nach ihrer Auffassung daraus folgenden Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) abgelehnt. Das Finanzamt hatte die Anforderung der Unterlagen mit steuerlicher Relevanz begründet.
Der BFH entschied, dass eine Anforderung von Unterlagen zum Mietverhältnis durch das Finanzamt zwar datenschutzrechtlich relevant sei, ein Vermieter allerdings nach der Abgabenordnung zur Vorlage bei steuerlicher Relevanz verpflichtet sei, in der Regel vollständig und ungeschwärzt. Das Finanzamt müsse begründen, warum eine steuerliche Relevanz vorliege und die angeforderten Unterlagen genau bezeichnen. In diesem Fall wiege das Interesse des Finanzamtes höher als das mögliche Datenschutzinteresse eines Mieters.
Vermieter sollten demnach immer nur die konkret bezeichneten Unterlagen herausgeben, um nicht mit der DSGVO in Konflikt zu geraten.
Wichtige Unterlagen, die angefordert werden können, sind:
Mietvertrag und Mieterhöhungen
Nebenkostenabrechnungen
Belege zu Instandhaltungs- und Erhaltungsaufwand
Belege über die Mieteinnahmen, z. B. Kontoauszüge
Eine Anforderung von Unterlagen, die steuerlich nicht relevant sind, ist nicht zulässig. Das Finanzamt muss verhältnismäßig vorgehen und darf keine Ausforschung anhand beliebiger Unterlagen betreiben. Herausgaben von derart angeforderten Unterlagen sind daher nicht notwendig.
⇑Eine Vermieterin hatte die Herausgabe unter Hinweis auf die fehlende Einwilligung des Mieters und nach ihrer Auffassung daraus folgenden Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) abgelehnt. Das Finanzamt hatte die Anforderung der Unterlagen mit steuerlicher Relevanz begründet.
Der BFH entschied, dass eine Anforderung von Unterlagen zum Mietverhältnis durch das Finanzamt zwar datenschutzrechtlich relevant sei, ein Vermieter allerdings nach der Abgabenordnung zur Vorlage bei steuerlicher Relevanz verpflichtet sei, in der Regel vollständig und ungeschwärzt. Das Finanzamt müsse begründen, warum eine steuerliche Relevanz vorliege und die angeforderten Unterlagen genau bezeichnen. In diesem Fall wiege das Interesse des Finanzamtes höher als das mögliche Datenschutzinteresse eines Mieters.
Vermieter sollten demnach immer nur die konkret bezeichneten Unterlagen herausgeben, um nicht mit der DSGVO in Konflikt zu geraten.
Wichtige Unterlagen, die angefordert werden können, sind:
Mietvertrag und Mieterhöhungen
Nebenkostenabrechnungen
Belege zu Instandhaltungs- und Erhaltungsaufwand
Belege über die Mieteinnahmen, z. B. Kontoauszüge
Eine Anforderung von Unterlagen, die steuerlich nicht relevant sind, ist nicht zulässig. Das Finanzamt muss verhältnismäßig vorgehen und darf keine Ausforschung anhand beliebiger Unterlagen betreiben. Herausgaben von derart angeforderten Unterlagen sind daher nicht notwendig.
Geschenkt: Einlage des Familienheims in eine GbR
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu entscheiden, ob die Einbringung eines Familien-heims durch einen Alleineigentümer-Ehegatten in eine GbR, an der beide Ehegatten je zur Hälfte beteiligt sind, zur Festsetzung von Schenkungsteuer gegenüber dem anderen, beschenkten Ehegat-ten führt. Im notariellen Vertrag wurde die Einbringung als unentgeltliche, ehebedingte Zuwen-dung der Ehefrau an den Ehemann, den Kläger, bezeichnet. Beide Eheleute wurden als Gesell-schafter und Eigentümer des Grundstücks in das Grundbuch eingetragen.
Das Finanzamt (FA) hatte, obwohl unstreitig war, dass es sich um ein Familienheim handelte, Schenkungsteuer gegen den Kläger als Begünstigten festgesetzt. Die Voraussetzungen für das Bestehen eines Familienheims sind u. a., dass die Wohnung den Lebensmittelpunkt darstellen muss, Nutzung durch den Schenker bis zur Schenkung und anschließende Nutzung durch den Beschenkten. Zur Begründung führte das FA an, dass wegen der Übertragung der Immobilie auf die GbR die Steuerfreiheit eines Familienheims nicht anwendbar sei. Die Hälfte sei dem Kläger zuzurechnen und Schenkungsteuer zu erheben. Der Einspruch blieb erfolglos. Das erstinstanzliche Finanzgericht gab der Klage statt und änderte die Schenkungsteuer auf 0 € mit der Begründung, dass auch der Erwerb von Gesamthandseigentum steuerfrei als Familienheim möglich sei. Der BFH sah die Revision des FA als unbegründet an und wies sie zurück.
Nach Auffassung des BFH ist bei einer GbR der einzelne Gesellschafter Steuerschuldner und nicht die Gesamthandgemeinschaft, obwohl die GbR teilrechts- und eintragungsfähig ist. Demnach ist ein bebautes Grundstück auch ein Familienheim, welches den inneren Kern der Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft eines Paares betrifft. Dieses hat der Gesetzgeber ausdrücklich privilegiert und steuerfrei gestellt.
⇑Das Finanzamt (FA) hatte, obwohl unstreitig war, dass es sich um ein Familienheim handelte, Schenkungsteuer gegen den Kläger als Begünstigten festgesetzt. Die Voraussetzungen für das Bestehen eines Familienheims sind u. a., dass die Wohnung den Lebensmittelpunkt darstellen muss, Nutzung durch den Schenker bis zur Schenkung und anschließende Nutzung durch den Beschenkten. Zur Begründung führte das FA an, dass wegen der Übertragung der Immobilie auf die GbR die Steuerfreiheit eines Familienheims nicht anwendbar sei. Die Hälfte sei dem Kläger zuzurechnen und Schenkungsteuer zu erheben. Der Einspruch blieb erfolglos. Das erstinstanzliche Finanzgericht gab der Klage statt und änderte die Schenkungsteuer auf 0 € mit der Begründung, dass auch der Erwerb von Gesamthandseigentum steuerfrei als Familienheim möglich sei. Der BFH sah die Revision des FA als unbegründet an und wies sie zurück.
Nach Auffassung des BFH ist bei einer GbR der einzelne Gesellschafter Steuerschuldner und nicht die Gesamthandgemeinschaft, obwohl die GbR teilrechts- und eintragungsfähig ist. Demnach ist ein bebautes Grundstück auch ein Familienheim, welches den inneren Kern der Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft eines Paares betrifft. Dieses hat der Gesetzgeber ausdrücklich privilegiert und steuerfrei gestellt.
Workation: Was Arbeitgeber und Arbeitnehmer beachten müssen
Ermöglichen in Deutschland ansässige Unternehmen ihrer Belegschaft das kurzfristige mobile Arbeiten aus dem Ausland, auch Workation genannt, ist dies für viele Jobsuchende eines von mehreren Kriterien, sich für oder gegen eine Arbeitsaufnahme in dem betreffenden Unternehmen oder für einen Jobwechsel zu entscheiden. Mittlerweile erwarten laut einer Workation-Studie deutlich mehr als die Hälfte der Beschäftigten von ihren Arbeitgebern, dass mobiles Arbeiten nicht nur im Inland, sondern auch aus dem Ausland ermöglicht wird.
Gleichwohl sind sowohl die Unternehmen als auch die Beschäftigten oft nicht hinreichend über die rechtlichen und steuerlichen Voraussetzungen und Folgen informiert. In den Arbeitsverträgen und Zusatzvereinbarungen finden sich häufig keine rechtssicheren Vereinbarungen.
Deutlich definierte Regelungen sind allein aus Haftungsgründen sehr wichtig. Die Unternehmen sollten daher steuer-, arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Regelungen vorab prüfen bzw. prüfen lassen. Workation ist deutlich abzugrenzen von einer dauerhaften Tätigkeit im Ausland für das Unternehmen, aber auch die Arbeit in einer ausländischen Niederlassung eines deutschen Unternehmens stellt keine Workation dar.
Folgende Punkte sollten vorab geklärt bzw. vertraglich vereinbart werden:
Achtung: Wer ohne Arbeitserlaubnis arbeitet, gilt als illegal beschäftigt, kann ggf. ausgewiesen und mit Einreiseverboten belegt werden. Für den Arbeitgeber kann ein derartiges Vorgehen zu einer Gewerbeuntersagung mit hohen Bußgeldern führen.
Die Beachtung der sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen und Folgen sind ebenfalls wichtig.
Wenn ein Arbeitgeber einer Workation im EU-Ausland zustimmt, gilt dieser Umstand sozialversicherungsrechtlich als Entsendung. Der Arbeitgeber verpflichtet sich damit, für das Bestehen eines Krankenversicherungsschutzes seiner Mitarbeiter und der mitreisenden Familienangehörigen zu haften bzw. dafür Sorge zu tragen, dass dieser besteht.
Die vorübergehende Entsendung eines Mitarbeiters aus Deutschland im Auftrag des inländischen Unternehmens in das europäische Ausland muss im Voraus zeitlich befristet sein. Das Entgelt muss in Deutschland abgerechnet werden. Eine Auslandsentsendung liegt nicht vor, wenn die entsandte Person im Ausland lebt und von einem deutschen Unternehmen für eine Tätigkeit in ihrem Heimatstaat oder einem anderen Land eingestellt wird. Die Person darf vor der Tätigkeit nicht in Deutschland beschäftigt gewesen sein oder zuvor in Deutschland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt gehabt haben.
⇑Gleichwohl sind sowohl die Unternehmen als auch die Beschäftigten oft nicht hinreichend über die rechtlichen und steuerlichen Voraussetzungen und Folgen informiert. In den Arbeitsverträgen und Zusatzvereinbarungen finden sich häufig keine rechtssicheren Vereinbarungen.
Deutlich definierte Regelungen sind allein aus Haftungsgründen sehr wichtig. Die Unternehmen sollten daher steuer-, arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Regelungen vorab prüfen bzw. prüfen lassen. Workation ist deutlich abzugrenzen von einer dauerhaften Tätigkeit im Ausland für das Unternehmen, aber auch die Arbeit in einer ausländischen Niederlassung eines deutschen Unternehmens stellt keine Workation dar.
Folgende Punkte sollten vorab geklärt bzw. vertraglich vereinbart werden:
- Innerbetriebliche Regelungen sollten klarstellen, welche Beschäftigungsgruppen das Workation-Angebot nutzen können.
- Bei einer vorübergehenden Workation bis zu 4 Wochen gilt deutsches Arbeitsrecht, Feiertage am Arbeitsort gelten auch für den Beschäftigten.
- Bei einer länger als 4 Wochen andauernden Workation muss das Unternehmen den Beschäftigten einen schriftlichen Nachweis hierüber sowie weitere Angaben aushändigen, z. B. über die Dauer des Aufenthalts und die Währung, in der das Arbeitsentgelt gezahlt wird (Nachweisgesetz).
- Bei einer mehr als 6 Monate andauernden Workation gilt das Arbeitsrecht des Workation-Landes im Hinblick auf Entlohnung, Kündigungsfristen, Arbeitszeiten und Urlaubsansprüche.
- Längere Workation in Nicht-EU-Ländern führen i. d. R. zur Notwendigkeit eines Visums, ein Touristenvisum ist nicht ausreichend. Ggf. ist ein Arbeits- oder spezielles Workationsvisum zu beantragen, welches es in einigen Ländern bereits gibt.
Achtung: Wer ohne Arbeitserlaubnis arbeitet, gilt als illegal beschäftigt, kann ggf. ausgewiesen und mit Einreiseverboten belegt werden. Für den Arbeitgeber kann ein derartiges Vorgehen zu einer Gewerbeuntersagung mit hohen Bußgeldern führen.
- Innerhalb der EU, der EWR und der Schweiz können Beschäftigte sich zu Arbeitszwecken uneingeschränkt aufhalten. Ein Visum wird nicht benötigt. Allerdings sind in den meisten Ländern Melde- oder Registrierpflichten zu beachten.
- Wer max. 183 Tage im Jahr im Ausland arbeitet, bleibt in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, bei längerem Aufenthalt entsteht die Steuerpflicht im Ausland.
- Dauert eine Workation länger als 4 Wochen, muss insbesondere der Arbeitgeber arbeits- und steuerrechtliche Folgen beachten. Hierüber sollte der Arbeitgeber sich auch immer selbstständig informieren.
Die Beachtung der sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen und Folgen sind ebenfalls wichtig.
- Bei einer Workation im Drittland - außerhalb der EU - muss geprüft werden, ob zwischen Deutschland und dem jeweiligen Staat ein Sozialversicherungsabkommen besteht. Diese Information sollte rechtzeitig eingeholt werden. Beratung bzw. Rücksprache mit einer Fachkraft in Auslandsentsendungsfragen ist hier hilfreich.
- Bei einer Workation innerhalb der EU, EWR oder Schweiz benötigt der Arbeitnehmer eine sog. A1-Bescheinigung, die dem Nachweis der Versicherungszugehörigkeit dient und elektronisch vom Arbeitgeber oder Arbeitnehmer beantragt werden kann.
- Zu beachten ist, dass auch Grenzgänger seit 2025 eine solche A1-Bescheinigung benötigen, selbst wenn keine Workation stattfindet.
Wenn ein Arbeitgeber einer Workation im EU-Ausland zustimmt, gilt dieser Umstand sozialversicherungsrechtlich als Entsendung. Der Arbeitgeber verpflichtet sich damit, für das Bestehen eines Krankenversicherungsschutzes seiner Mitarbeiter und der mitreisenden Familienangehörigen zu haften bzw. dafür Sorge zu tragen, dass dieser besteht.
Die vorübergehende Entsendung eines Mitarbeiters aus Deutschland im Auftrag des inländischen Unternehmens in das europäische Ausland muss im Voraus zeitlich befristet sein. Das Entgelt muss in Deutschland abgerechnet werden. Eine Auslandsentsendung liegt nicht vor, wenn die entsandte Person im Ausland lebt und von einem deutschen Unternehmen für eine Tätigkeit in ihrem Heimatstaat oder einem anderen Land eingestellt wird. Die Person darf vor der Tätigkeit nicht in Deutschland beschäftigt gewesen sein oder zuvor in Deutschland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt gehabt haben.
Bundesfinanzhof entscheidet zur Grundsteuer im „Bundesmodell“
Der Bundesfinanzhof wird am 10.12.2025 (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) in drei Verfahren öffentlich seine Entscheidungen verkünden.
Dies ist insbesondere für Grundstückseigentümer in den Bundesländern interessant, welche die Grundsteuerreform nach dem Bundesmodell umgesetzt haben. Dies sind die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Das Saarland und Sachsen nutzen ebenfalls die Bundesregelungen mit Abweichungen bei der Steuermesszahl.
Das Bundesmodell stellt den Grundstückwert für Wohngrundstücke anhand der Grundstücks- und Wohnfläche sowie des Bodenrichtwerts, Gebäudeart und Baujahr fest. Die drei Verfahren, die zur Entscheidung anstehen, haben gemeinsam, dass die Verfassungsmäßigkeit des für Grundsteuerzwecke pauschalierten Ertragswertverfahrens streitig ist.
Das pauschalierte Ertragswertverfahren findet Anwendung auf Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke und Eigentumswohnungen. Auch für die Erbschaft- und Schenkungsteuer wird teilweise das Ertragswertverfahren angewendet, allerdings im Gegensatz zur Grundsteuer wird dort z. B. nach den tatsächlichen Nettomieten bewertet und nicht nach landeseinheitlich geltenden Nettokaltmieten. Eine Unterscheidung gibt es bei der Grundsteuer lediglich nach Gebäudeart, Baujahr und Wohnflächengruppe, die über Zu- und Abschläge zum Ausdruck gebracht werden. So findet z. B. auch keine Unterscheidung der Mietniveaustufen nach Stadtlage oder ländlicher Lage statt.
Die Frage, die der BFH zu beantworten haben wird, ist, ob es mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist, in einer Vielzahl von Grundsteuerverfahren mit einem grob vereinfachten Verfahrensansatz wie durch Gutachterausschüsse festgestellte Bodenrichtwerte und pauschalierte Nettokaltmieten den Wert eines Grundstücks bzw. einer Wohneinheit zu bestimmen.
Es sind derzeit ca. 2.000 Klageverfahren zu unterschiedlichen Grundsteuermodellen rechtshängig, beim BFH sind es 15 Verfahren.
⇑Dies ist insbesondere für Grundstückseigentümer in den Bundesländern interessant, welche die Grundsteuerreform nach dem Bundesmodell umgesetzt haben. Dies sind die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Das Saarland und Sachsen nutzen ebenfalls die Bundesregelungen mit Abweichungen bei der Steuermesszahl.
Das Bundesmodell stellt den Grundstückwert für Wohngrundstücke anhand der Grundstücks- und Wohnfläche sowie des Bodenrichtwerts, Gebäudeart und Baujahr fest. Die drei Verfahren, die zur Entscheidung anstehen, haben gemeinsam, dass die Verfassungsmäßigkeit des für Grundsteuerzwecke pauschalierten Ertragswertverfahrens streitig ist.
Das pauschalierte Ertragswertverfahren findet Anwendung auf Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke und Eigentumswohnungen. Auch für die Erbschaft- und Schenkungsteuer wird teilweise das Ertragswertverfahren angewendet, allerdings im Gegensatz zur Grundsteuer wird dort z. B. nach den tatsächlichen Nettomieten bewertet und nicht nach landeseinheitlich geltenden Nettokaltmieten. Eine Unterscheidung gibt es bei der Grundsteuer lediglich nach Gebäudeart, Baujahr und Wohnflächengruppe, die über Zu- und Abschläge zum Ausdruck gebracht werden. So findet z. B. auch keine Unterscheidung der Mietniveaustufen nach Stadtlage oder ländlicher Lage statt.
Die Frage, die der BFH zu beantworten haben wird, ist, ob es mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist, in einer Vielzahl von Grundsteuerverfahren mit einem grob vereinfachten Verfahrensansatz wie durch Gutachterausschüsse festgestellte Bodenrichtwerte und pauschalierte Nettokaltmieten den Wert eines Grundstücks bzw. einer Wohneinheit zu bestimmen.
Es sind derzeit ca. 2.000 Klageverfahren zu unterschiedlichen Grundsteuermodellen rechtshängig, beim BFH sind es 15 Verfahren.
Terminsache: Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 10.2.2026
Unternehmen, die ihre monatlichen Umsatzsteuervoranmeldungen nicht zum 10. des Folgemonats einreichen bzw. -vorauszahlungen nicht bis zum 13. des Folgemonats leisten möchten, können bis zum 10.2.2026 für das Jahr 2026 einen Antrag auf eine sog. Dauerfristverlängerung stellen. Es ist eine Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung i. H. v. einem Elftel der Umsatzsteuerzahllast des Vorjahres an das Finanzamt zu leisten. Die Umsatzsteuervoranmeldungen bzw. -zahlungen dürfen jeweils einen Monat später abgegeben bzw. gezahlt werden. Quartalszahler müssen keine Sondervorauszahlungen leisten. Die Höhe der jeweiligen Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung kann ab dem 1.1.2026 über ELSTER abgerufen werden. Die Sondervorauszahlung wird mit der Umsatzsteuervorauszahlung für Dezember verrechnet.
Achtung: Seit dem 9.10.2025 sind Banken zur Verhinderung von Online-Fehlüberweisungen und Betrug verpflichtet, den Empfängernamen mit der IBAN abzugleichen. Stimmen Empfängername und IBAN nicht überein, wird die Überweisung zunächst nicht ausgeführt. Der Kunde wird auf einen abweichenden Kontoinhaber hingewiesen und kann aktiv auswählen. Mit einer Bestätigung durch den Kunden haftet die Bank nicht mehr für Fehlüberweisungen. Dieses gilt insbesondere auch bei Echtzeitüberweisungen. Bei Papierüberweisungen gilt diese Regelung nicht.
Auf Steuerbescheiden stehen nicht immer die Empfängerangaben, sondern mitunter lediglich die IBAN. Es gilt daher, rechtzeitig den Abgleich vorzunehmen, um Zahlungsfristen nicht zu verpassen.
⇑Achtung: Seit dem 9.10.2025 sind Banken zur Verhinderung von Online-Fehlüberweisungen und Betrug verpflichtet, den Empfängernamen mit der IBAN abzugleichen. Stimmen Empfängername und IBAN nicht überein, wird die Überweisung zunächst nicht ausgeführt. Der Kunde wird auf einen abweichenden Kontoinhaber hingewiesen und kann aktiv auswählen. Mit einer Bestätigung durch den Kunden haftet die Bank nicht mehr für Fehlüberweisungen. Dieses gilt insbesondere auch bei Echtzeitüberweisungen. Bei Papierüberweisungen gilt diese Regelung nicht.
Auf Steuerbescheiden stehen nicht immer die Empfängerangaben, sondern mitunter lediglich die IBAN. Es gilt daher, rechtzeitig den Abgleich vorzunehmen, um Zahlungsfristen nicht zu verpassen.
Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge wird verlängert
Das Bundeskabinett hat am 15.10.2025 beschlossen, dass die KFZ-Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 2035 verlängert werden soll. Die erste Lesung im Bundestag hat am 14.11.2025 stattgefunden. Der Gesetzentwurf wurde zur weiteren Debatte in die Fachausschüsse verwiesen.
Die Steuerbefreiung soll für Fahrzeuge gelten, die spätestens bis zum 31.12.2030 erstmalig für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen werden. Die Steuerbefreiung gilt bis zu 10 Jahre, längstens jedoch bis zum 31.12.2035.
Die Stellungnahme des Bundesrates steht noch aus.
Ohne eines Änderung des Gesetzes wären nur noch reine Elektrofahrzeuge von der KFZ-Steuer befreit, die vor dem 1.1.2026 erstmalig zugelassen werden.
⇑Die Steuerbefreiung soll für Fahrzeuge gelten, die spätestens bis zum 31.12.2030 erstmalig für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen werden. Die Steuerbefreiung gilt bis zu 10 Jahre, längstens jedoch bis zum 31.12.2035.
Die Stellungnahme des Bundesrates steht noch aus.
Ohne eines Änderung des Gesetzes wären nur noch reine Elektrofahrzeuge von der KFZ-Steuer befreit, die vor dem 1.1.2026 erstmalig zugelassen werden.
Keine erste Tätigkeitsstätte bei unbefristetem Leiharbeitsverhältnis
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass dem unbefristet beschäftigten Arbeitnehmer im Rahmen eines Leiharbeitsverhältnisses üblicherweise keine erste Tätigkeitsstätte zugeordnet werden kann, auch dann nicht, wenn er dauerhaft im Rahmen des Leiharbeitsverhältnisses in einem Betrieb eingesetzt wird.
Der im Rahmen eines zunächst befristeten und später unbefristeten Leiharbeitsverhältnisses beschäftigte Arbeitnehmer wurde langfristig in dem gleichen Betrieb eingesetzt.
Im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung machte er die entstandenen Fahrtkosten zu seinem Einsatzort nicht als Werbungskosten geltend, sondern mit den höheren, für ihn vorteilhafteren Fahrtkostenpauschalen als Auswärtstätigkeit.
Dies hat das Finanzamt abgelehnt und lediglich den Werbungskostenabzug zugelassen. Der BFH hat sich jedoch der Auffassung des Klägers angeschlossen.
Zur Begründung führte der BFH aus, dass die Tätigkeit eines Leiharbeitnehmers aufgrund der Vereinbarung zwischen Entleiher und Verleiher in der Regel lediglich eine vorübergehende und keine dauerhafte Tätigkeit im Betrieb des Entleihers darstellt. Darüber hinaus gelte seit April 2017 die Regelung, dass ein Leiharbeitnehmer nicht länger als 18 Monate im gleichen Betrieb beschäftigt werden dürfe, was in der Regelung für eine nicht dauerhafte Beschäftigung im gleichen Betrieb spreche. Grundsätzlich ist bei einem Leiharbeitnehmer davon auszugehen, dass ein vorübergehender und kein dauerhafter Einsatzort gegeben sei.
Da der Werbungskostenabzug bei einer dauerhaften ersten Tätigkeitsstätte erfolgt, bei vorübergehender Tätigkeit mit üblicherweise wechselnden Tätigkeitsstätten die höheren Fahrtkostenpauschalen für Auswärtstätigkeit in Abzug gebracht werden können, gab der BFH der Klage statt.
⇑Der im Rahmen eines zunächst befristeten und später unbefristeten Leiharbeitsverhältnisses beschäftigte Arbeitnehmer wurde langfristig in dem gleichen Betrieb eingesetzt.
Im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung machte er die entstandenen Fahrtkosten zu seinem Einsatzort nicht als Werbungskosten geltend, sondern mit den höheren, für ihn vorteilhafteren Fahrtkostenpauschalen als Auswärtstätigkeit.
Dies hat das Finanzamt abgelehnt und lediglich den Werbungskostenabzug zugelassen. Der BFH hat sich jedoch der Auffassung des Klägers angeschlossen.
Zur Begründung führte der BFH aus, dass die Tätigkeit eines Leiharbeitnehmers aufgrund der Vereinbarung zwischen Entleiher und Verleiher in der Regel lediglich eine vorübergehende und keine dauerhafte Tätigkeit im Betrieb des Entleihers darstellt. Darüber hinaus gelte seit April 2017 die Regelung, dass ein Leiharbeitnehmer nicht länger als 18 Monate im gleichen Betrieb beschäftigt werden dürfe, was in der Regelung für eine nicht dauerhafte Beschäftigung im gleichen Betrieb spreche. Grundsätzlich ist bei einem Leiharbeitnehmer davon auszugehen, dass ein vorübergehender und kein dauerhafter Einsatzort gegeben sei.
Da der Werbungskostenabzug bei einer dauerhaften ersten Tätigkeitsstätte erfolgt, bei vorübergehender Tätigkeit mit üblicherweise wechselnden Tätigkeitsstätten die höheren Fahrtkostenpauschalen für Auswärtstätigkeit in Abzug gebracht werden können, gab der BFH der Klage statt.
Sonderabschreibung: Neuer Ersatzbau = Neubau?
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat Ende Oktober 2025 ein bereits seit längerer Zeit erwartetes Urteil vom 12.8.2025 zur Sonderabschreibungsmöglichkeit von Mietwohnungsneubau veröffentlicht.
Im Klageverfahren ging es um einen ersten Förderzeitraum, für den die Wohnungsherstellung durch Bauantrag oder Bauanzeige nach dem 31.8.2018, aber vor dem 1.1.2022 begann. Aktuell gibt es einen zweiten Förderzeitraum für Bauanträge oder Bauanzeigen über Wohnungsherstellungen, die nach dem 31.12.2022, aber vor dem 1.10.2029 begannen.
Die Kläger hatten im ersten Förderzeitraum ein vermietetes, nutzbares Einfamilienhaus nach Kündigung und Auszug der Mieter abgerissen, weil eine behördliche Aufforderung zur Sanierung der Abwasserrohre erfolgt war. Auf dem Grundstück wurde ebenfalls wieder ein Einfamilienhaus errichtet, über welches auch ein Mietvertrag mit Mietern abgeschlossen wurde. Das Finanzamt wollte die von den Klägern geltend gemachte Sonderabschreibung nicht als Werbungskosten anerkennen, da es sich zwar um einen Neubau handelte, aber kein zusätzlicher Wohnraum geschaffen worden sei. Abriss und Neubau erfolgten innerhalb eines Zeitraumes von ca. 1,5 Jahren.
Weder die Gesetzesbegründung noch die Finanzverwaltung äußerten sich im Vorfeld bzw. im Nachgang des Gesetzgebungsverfahrens dazu, ob die Formulierung „neue, bisher nicht vorhandene Wohnung hergestellt“ so zu verstehen sei, dass ein neuer Ersatzbau, der keinen zusätzlichen Wohnraum schaffe, auch nicht förderfähig sei oder ob eine Rückschau auf das abgerissene Gebäude relevant sei, womöglich durch einen Wohnflächenvergleich und Gebäudeart vor und nach dem Abriss.
Sowohl das erstinstanzliche Finanzgericht Köln als auch der BFH haben die Fördervoraussetzungen für die Sonderabschreibung als nicht gegeben angesehen.
Der BFH stellte in seiner Entscheidung im Wesentlichen darauf ab, dass ein Ersetzen vorhandener Wohnungen durch einen gleichartigen Neubau keine „neue, bisher nicht vorhandene Wohnung“ darstelle. Dies könne allerdings anders sein, wenn der Abriss und der Neubau einer Wohnung nicht im zeitlichen Zusammenhang stehen wie im zu entscheidenden Fall.
Sinn und Zweck der Norm und der Förderung sei es, eine Vermehrung von Wohnraum zu erreichen und diesen nicht lediglich zu ersetzen. Mit der Förderung durch die Sonderabschreibung sollte der Wohnungsknappheit entgegengewirkt werden.
Im aktuellen zweiten Förderzeitraum, über den im Urteil nicht zu entscheiden war, heißt es nur noch „neue“ Wohnung mit den Kriterien des „Effizienzhaus 40“ mit Nachhaltigkeitsfaktor.
Der BFH hat in seiner Entscheidung allerdings bereits anklingen lassen, dass auch hier die gleichen Parameter gelten könnten.
Insoweit dürfte, wenn weder die Finanzverwaltung noch der Gesetzgeber klärend eingreifen, mit einer Vielzahl an Klageverfahren zu rechnen sein.
Betroffene Steuerpflichtige sollten sich umgehend steuerlich beraten lassen, wenn das zuständige Finanzamt die Sonderabschreibung nicht anerkannt hat.
⇑Im Klageverfahren ging es um einen ersten Förderzeitraum, für den die Wohnungsherstellung durch Bauantrag oder Bauanzeige nach dem 31.8.2018, aber vor dem 1.1.2022 begann. Aktuell gibt es einen zweiten Förderzeitraum für Bauanträge oder Bauanzeigen über Wohnungsherstellungen, die nach dem 31.12.2022, aber vor dem 1.10.2029 begannen.
Die Kläger hatten im ersten Förderzeitraum ein vermietetes, nutzbares Einfamilienhaus nach Kündigung und Auszug der Mieter abgerissen, weil eine behördliche Aufforderung zur Sanierung der Abwasserrohre erfolgt war. Auf dem Grundstück wurde ebenfalls wieder ein Einfamilienhaus errichtet, über welches auch ein Mietvertrag mit Mietern abgeschlossen wurde. Das Finanzamt wollte die von den Klägern geltend gemachte Sonderabschreibung nicht als Werbungskosten anerkennen, da es sich zwar um einen Neubau handelte, aber kein zusätzlicher Wohnraum geschaffen worden sei. Abriss und Neubau erfolgten innerhalb eines Zeitraumes von ca. 1,5 Jahren.
Weder die Gesetzesbegründung noch die Finanzverwaltung äußerten sich im Vorfeld bzw. im Nachgang des Gesetzgebungsverfahrens dazu, ob die Formulierung „neue, bisher nicht vorhandene Wohnung hergestellt“ so zu verstehen sei, dass ein neuer Ersatzbau, der keinen zusätzlichen Wohnraum schaffe, auch nicht förderfähig sei oder ob eine Rückschau auf das abgerissene Gebäude relevant sei, womöglich durch einen Wohnflächenvergleich und Gebäudeart vor und nach dem Abriss.
Sowohl das erstinstanzliche Finanzgericht Köln als auch der BFH haben die Fördervoraussetzungen für die Sonderabschreibung als nicht gegeben angesehen.
Der BFH stellte in seiner Entscheidung im Wesentlichen darauf ab, dass ein Ersetzen vorhandener Wohnungen durch einen gleichartigen Neubau keine „neue, bisher nicht vorhandene Wohnung“ darstelle. Dies könne allerdings anders sein, wenn der Abriss und der Neubau einer Wohnung nicht im zeitlichen Zusammenhang stehen wie im zu entscheidenden Fall.
Sinn und Zweck der Norm und der Förderung sei es, eine Vermehrung von Wohnraum zu erreichen und diesen nicht lediglich zu ersetzen. Mit der Förderung durch die Sonderabschreibung sollte der Wohnungsknappheit entgegengewirkt werden.
Im aktuellen zweiten Förderzeitraum, über den im Urteil nicht zu entscheiden war, heißt es nur noch „neue“ Wohnung mit den Kriterien des „Effizienzhaus 40“ mit Nachhaltigkeitsfaktor.
Der BFH hat in seiner Entscheidung allerdings bereits anklingen lassen, dass auch hier die gleichen Parameter gelten könnten.
Insoweit dürfte, wenn weder die Finanzverwaltung noch der Gesetzgeber klärend eingreifen, mit einer Vielzahl an Klageverfahren zu rechnen sein.
Betroffene Steuerpflichtige sollten sich umgehend steuerlich beraten lassen, wenn das zuständige Finanzamt die Sonderabschreibung nicht anerkannt hat.
Deutschlandticket 2026
Das Deutschlandticket soll auch in den Jahren 2026 – 2030 erhalten bleiben. Der aktuelle Bezugspreis von 58 € in 2025 soll lt. Vereinbarung der Verkehrsminister der Bundesländer in 2026 auf 63 € monatlich steigen. Auch im Jahr 2026 können Zuschüsse zum Deutschlandticket durch den Arbeitgeber steuer- und sozialversicherungsfrei zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden. Der Zuschuss ist auf die Höhe der Aufwendungen des Arbeitnehmers begrenzt.
⇑Beitragsbemessungsgrenzen steigen ab 2026
Das Bundeskabinett hat am 8.10.2025 eine Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen für 2026 um mehr als 5 % beschlossen, die Zustimmung des Bundesrates steht noch aus. Menschen mit höherem Einkommen müssen somit, sofern sie in das gesetzliche Sozialversicherungssystem einzahlen, auf einen höheren Anteil ihres Einkommens Beiträge abführen. Diese sehen wie folgt aus:
⇑| Sozialversicherungsrechengröße | Monat | Jahr |
| Bezugsgröße in der Sozialversicherung | 3.955 € | 47.460 € |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 6 SGB V (Versicherungspflichtgrenze) in der Kranken- und Pflegeversicherung |
6.450 € | 77.400 € |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 7 SGB V (Beitragsbemessungsgrenze) in der Kranken- und Pflegeversicherung |
5.812,50 € | 69.750 € |
| Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Renten- und Arbeitslosenversicherung | 8.450 € | 101.400 € |
| Beitragsbemessungsgrenze in der knappschaftlichen Rentenversicherung | 10.400 € | 124.800 € |
| vorläufiges Durchschnittsentgelt 2026 in der Rentenversicherung |
- | 51.944 € |
| (endgültiges) Durchschnittsentgelt 2024 in der Rentenversicherung |
- | 47.085 € |
Anforderung von Unterlagen durch das Finanzamt zulässig
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu befinden, ob die Anforderung von Mietverträgen, Nebenkostenabrechnungen, Mieterhöhungsschreiben, Belegen über Erhaltungsaufwand und ähnlichen Unterlagen durch das Finanzamt bei einem Vermieter von Wohnraum zulässig ist bzw. der Vermieter die Vorlage ohne Zustimmung des Mieters verweigern darf.
Eine Vermieterin hatte die Herausgabe unter Hinweis auf die fehlende Einwilligung des Mieters und nach ihrer Auffassung daraus folgenden Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) abgelehnt. Das Finanzamt hatte die Anforderung der Unterlagen mit steuerlicher Relevanz begründet.
Der BFH entschied, dass eine Anforderung von Unterlagen zum Mietverhältnis durch das Finanzamt zwar datenschutzrechtlich relevant sei, ein Vermieter allerdings nach der Abgabenordnung zur Vorlage bei steuerlicher Relevanz verpflichtet sei, in der Regel vollständig und ungeschwärzt. Das Finanzamt müsse begründen, warum eine steuerliche Relevanz vorliege und die angeforderten Unterlagen genau bezeichnen. In diesem Fall wiege das Interesse des Finanzamtes höher als das mögliche Datenschutzinteresse eines Mieters.
Vermieter sollten demnach immer nur die konkret bezeichneten Unterlagen herausgeben, um nicht mit der DSGVO in Konflikt zu geraten.
Wichtige Unterlagen, die angefordert werden können, sind:
Mietvertrag und Mieterhöhungen
Nebenkostenabrechnungen
Belege zu Instandhaltungs- und Erhaltungsaufwand
Belege über die Mieteinnahmen, z. B. Kontoauszüge
Eine Anforderung von Unterlagen, die steuerlich nicht relevant sind, ist nicht zulässig. Das Finanzamt muss verhältnismäßig vorgehen und darf keine Ausforschung anhand beliebiger Unterlagen betreiben. Herausgaben von derart angeforderten Unterlagen sind daher nicht notwendig.
⇑Eine Vermieterin hatte die Herausgabe unter Hinweis auf die fehlende Einwilligung des Mieters und nach ihrer Auffassung daraus folgenden Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) abgelehnt. Das Finanzamt hatte die Anforderung der Unterlagen mit steuerlicher Relevanz begründet.
Der BFH entschied, dass eine Anforderung von Unterlagen zum Mietverhältnis durch das Finanzamt zwar datenschutzrechtlich relevant sei, ein Vermieter allerdings nach der Abgabenordnung zur Vorlage bei steuerlicher Relevanz verpflichtet sei, in der Regel vollständig und ungeschwärzt. Das Finanzamt müsse begründen, warum eine steuerliche Relevanz vorliege und die angeforderten Unterlagen genau bezeichnen. In diesem Fall wiege das Interesse des Finanzamtes höher als das mögliche Datenschutzinteresse eines Mieters.
Vermieter sollten demnach immer nur die konkret bezeichneten Unterlagen herausgeben, um nicht mit der DSGVO in Konflikt zu geraten.
Wichtige Unterlagen, die angefordert werden können, sind:
Mietvertrag und Mieterhöhungen
Nebenkostenabrechnungen
Belege zu Instandhaltungs- und Erhaltungsaufwand
Belege über die Mieteinnahmen, z. B. Kontoauszüge
Eine Anforderung von Unterlagen, die steuerlich nicht relevant sind, ist nicht zulässig. Das Finanzamt muss verhältnismäßig vorgehen und darf keine Ausforschung anhand beliebiger Unterlagen betreiben. Herausgaben von derart angeforderten Unterlagen sind daher nicht notwendig.
Geschenkt: Einlage des Familienheims in eine GbR
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu entscheiden, ob die Einbringung eines Familien-heims durch einen Alleineigentümer-Ehegatten in eine GbR, an der beide Ehegatten je zur Hälfte beteiligt sind, zur Festsetzung von Schenkungsteuer gegenüber dem anderen, beschenkten Ehegat-ten führt. Im notariellen Vertrag wurde die Einbringung als unentgeltliche, ehebedingte Zuwen-dung der Ehefrau an den Ehemann, den Kläger, bezeichnet. Beide Eheleute wurden als Gesell-schafter und Eigentümer des Grundstücks in das Grundbuch eingetragen.
Das Finanzamt (FA) hatte, obwohl unstreitig war, dass es sich um ein Familienheim handelte, Schenkungsteuer gegen den Kläger als Begünstigten festgesetzt. Die Voraussetzungen für das Bestehen eines Familienheims sind u. a., dass die Wohnung den Lebensmittelpunkt darstellen muss, Nutzung durch den Schenker bis zur Schenkung und anschließende Nutzung durch den Beschenkten. Zur Begründung führte das FA an, dass wegen der Übertragung der Immobilie auf die GbR die Steuerfreiheit eines Familienheims nicht anwendbar sei. Die Hälfte sei dem Kläger zuzurechnen und Schenkungsteuer zu erheben. Der Einspruch blieb erfolglos. Das erstinstanzliche Finanzgericht gab der Klage statt und änderte die Schenkungsteuer auf 0 € mit der Begründung, dass auch der Erwerb von Gesamthandseigentum steuerfrei als Familienheim möglich sei. Der BFH sah die Revision des FA als unbegründet an und wies sie zurück.
Nach Auffassung des BFH ist bei einer GbR der einzelne Gesellschafter Steuerschuldner und nicht die Gesamthandgemeinschaft, obwohl die GbR teilrechts- und eintragungsfähig ist. Demnach ist ein bebautes Grundstück auch ein Familienheim, welches den inneren Kern der Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft eines Paares betrifft. Dieses hat der Gesetzgeber ausdrücklich privilegiert und steuerfrei gestellt.
⇑Das Finanzamt (FA) hatte, obwohl unstreitig war, dass es sich um ein Familienheim handelte, Schenkungsteuer gegen den Kläger als Begünstigten festgesetzt. Die Voraussetzungen für das Bestehen eines Familienheims sind u. a., dass die Wohnung den Lebensmittelpunkt darstellen muss, Nutzung durch den Schenker bis zur Schenkung und anschließende Nutzung durch den Beschenkten. Zur Begründung führte das FA an, dass wegen der Übertragung der Immobilie auf die GbR die Steuerfreiheit eines Familienheims nicht anwendbar sei. Die Hälfte sei dem Kläger zuzurechnen und Schenkungsteuer zu erheben. Der Einspruch blieb erfolglos. Das erstinstanzliche Finanzgericht gab der Klage statt und änderte die Schenkungsteuer auf 0 € mit der Begründung, dass auch der Erwerb von Gesamthandseigentum steuerfrei als Familienheim möglich sei. Der BFH sah die Revision des FA als unbegründet an und wies sie zurück.
Nach Auffassung des BFH ist bei einer GbR der einzelne Gesellschafter Steuerschuldner und nicht die Gesamthandgemeinschaft, obwohl die GbR teilrechts- und eintragungsfähig ist. Demnach ist ein bebautes Grundstück auch ein Familienheim, welches den inneren Kern der Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft eines Paares betrifft. Dieses hat der Gesetzgeber ausdrücklich privilegiert und steuerfrei gestellt.
Workation: Was Arbeitgeber und Arbeitnehmer beachten müssen
Ermöglichen in Deutschland ansässige Unternehmen ihrer Belegschaft das kurzfristige mobile Arbeiten aus dem Ausland, auch Workation genannt, ist dies für viele Jobsuchende eines von mehreren Kriterien, sich für oder gegen eine Arbeitsaufnahme in dem betreffenden Unternehmen oder für einen Jobwechsel zu entscheiden. Mittlerweile erwarten laut einer Workation-Studie deutlich mehr als die Hälfte der Beschäftigten von ihren Arbeitgebern, dass mobiles Arbeiten nicht nur im Inland, sondern auch aus dem Ausland ermöglicht wird.
Gleichwohl sind sowohl die Unternehmen als auch die Beschäftigten oft nicht hinreichend über die rechtlichen und steuerlichen Voraussetzungen und Folgen informiert. In den Arbeitsverträgen und Zusatzvereinbarungen finden sich häufig keine rechtssicheren Vereinbarungen.
Deutlich definierte Regelungen sind allein aus Haftungsgründen sehr wichtig. Die Unternehmen sollten daher steuer-, arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Regelungen vorab prüfen bzw. prüfen lassen. Workation ist deutlich abzugrenzen von einer dauerhaften Tätigkeit im Ausland für das Unternehmen, aber auch die Arbeit in einer ausländischen Niederlassung eines deutschen Unternehmens stellt keine Workation dar.
Folgende Punkte sollten vorab geklärt bzw. vertraglich vereinbart werden:
Achtung: Wer ohne Arbeitserlaubnis arbeitet, gilt als illegal beschäftigt, kann ggf. ausgewiesen und mit Einreiseverboten belegt werden. Für den Arbeitgeber kann ein derartiges Vorgehen zu einer Gewerbeuntersagung mit hohen Bußgeldern führen.
Die Beachtung der sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen und Folgen sind ebenfalls wichtig.
Wenn ein Arbeitgeber einer Workation im EU-Ausland zustimmt, gilt dieser Umstand sozialversicherungsrechtlich als Entsendung. Der Arbeitgeber verpflichtet sich damit, für das Bestehen eines Krankenversicherungsschutzes seiner Mitarbeiter und der mitreisenden Familienangehörigen zu haften bzw. dafür Sorge zu tragen, dass dieser besteht.
Die vorübergehende Entsendung eines Mitarbeiters aus Deutschland im Auftrag des inländischen Unternehmens in das europäische Ausland muss im Voraus zeitlich befristet sein. Das Entgelt muss in Deutschland abgerechnet werden. Eine Auslandsentsendung liegt nicht vor, wenn die entsandte Person im Ausland lebt und von einem deutschen Unternehmen für eine Tätigkeit in ihrem Heimatstaat oder einem anderen Land eingestellt wird. Die Person darf vor der Tätigkeit nicht in Deutschland beschäftigt gewesen sein oder zuvor in Deutschland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt gehabt haben.
⇑Gleichwohl sind sowohl die Unternehmen als auch die Beschäftigten oft nicht hinreichend über die rechtlichen und steuerlichen Voraussetzungen und Folgen informiert. In den Arbeitsverträgen und Zusatzvereinbarungen finden sich häufig keine rechtssicheren Vereinbarungen.
Deutlich definierte Regelungen sind allein aus Haftungsgründen sehr wichtig. Die Unternehmen sollten daher steuer-, arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Regelungen vorab prüfen bzw. prüfen lassen. Workation ist deutlich abzugrenzen von einer dauerhaften Tätigkeit im Ausland für das Unternehmen, aber auch die Arbeit in einer ausländischen Niederlassung eines deutschen Unternehmens stellt keine Workation dar.
Folgende Punkte sollten vorab geklärt bzw. vertraglich vereinbart werden:
- Innerbetriebliche Regelungen sollten klarstellen, welche Beschäftigungsgruppen das Workation-Angebot nutzen können.
- Bei einer vorübergehenden Workation bis zu 4 Wochen gilt deutsches Arbeitsrecht, Feiertage am Arbeitsort gelten auch für den Beschäftigten.
- Bei einer länger als 4 Wochen andauernden Workation muss das Unternehmen den Beschäftigten einen schriftlichen Nachweis hierüber sowie weitere Angaben aushändigen, z. B. über die Dauer des Aufenthalts und die Währung, in der das Arbeitsentgelt gezahlt wird (Nachweisgesetz).
- Bei einer mehr als 6 Monate andauernden Workation gilt das Arbeitsrecht des Workation-Landes im Hinblick auf Entlohnung, Kündigungsfristen, Arbeitszeiten und Urlaubsansprüche.
- Längere Workation in Nicht-EU-Ländern führen i. d. R. zur Notwendigkeit eines Visums, ein Touristenvisum ist nicht ausreichend. Ggf. ist ein Arbeits- oder spezielles Workationsvisum zu beantragen, welches es in einigen Ländern bereits gibt.
Achtung: Wer ohne Arbeitserlaubnis arbeitet, gilt als illegal beschäftigt, kann ggf. ausgewiesen und mit Einreiseverboten belegt werden. Für den Arbeitgeber kann ein derartiges Vorgehen zu einer Gewerbeuntersagung mit hohen Bußgeldern führen.
- Innerhalb der EU, der EWR und der Schweiz können Beschäftigte sich zu Arbeitszwecken uneingeschränkt aufhalten. Ein Visum wird nicht benötigt. Allerdings sind in den meisten Ländern Melde- oder Registrierpflichten zu beachten.
- Wer max. 183 Tage im Jahr im Ausland arbeitet, bleibt in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, bei längerem Aufenthalt entsteht die Steuerpflicht im Ausland.
- Dauert eine Workation länger als 4 Wochen, muss insbesondere der Arbeitgeber arbeits- und steuerrechtliche Folgen beachten. Hierüber sollte der Arbeitgeber sich auch immer selbstständig informieren.
Die Beachtung der sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen und Folgen sind ebenfalls wichtig.
- Bei einer Workation im Drittland - außerhalb der EU - muss geprüft werden, ob zwischen Deutschland und dem jeweiligen Staat ein Sozialversicherungsabkommen besteht. Diese Information sollte rechtzeitig eingeholt werden. Beratung bzw. Rücksprache mit einer Fachkraft in Auslandsentsendungsfragen ist hier hilfreich.
- Bei einer Workation innerhalb der EU, EWR oder Schweiz benötigt der Arbeitnehmer eine sog. A1-Bescheinigung, die dem Nachweis der Versicherungszugehörigkeit dient und elektronisch vom Arbeitgeber oder Arbeitnehmer beantragt werden kann.
- Zu beachten ist, dass auch Grenzgänger seit 2025 eine solche A1-Bescheinigung benötigen, selbst wenn keine Workation stattfindet.
Wenn ein Arbeitgeber einer Workation im EU-Ausland zustimmt, gilt dieser Umstand sozialversicherungsrechtlich als Entsendung. Der Arbeitgeber verpflichtet sich damit, für das Bestehen eines Krankenversicherungsschutzes seiner Mitarbeiter und der mitreisenden Familienangehörigen zu haften bzw. dafür Sorge zu tragen, dass dieser besteht.
Die vorübergehende Entsendung eines Mitarbeiters aus Deutschland im Auftrag des inländischen Unternehmens in das europäische Ausland muss im Voraus zeitlich befristet sein. Das Entgelt muss in Deutschland abgerechnet werden. Eine Auslandsentsendung liegt nicht vor, wenn die entsandte Person im Ausland lebt und von einem deutschen Unternehmen für eine Tätigkeit in ihrem Heimatstaat oder einem anderen Land eingestellt wird. Die Person darf vor der Tätigkeit nicht in Deutschland beschäftigt gewesen sein oder zuvor in Deutschland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt gehabt haben.
Beitrag zur freiwilligen privaten Pflegeversicherung als Sonderausgabe
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat als Revisionsinstanz entschieden, dass neben den Beiträgen zu einer privaten Basiskrankenversicherung lediglich die Beiträge zur privaten Pflegepflichtversicherung der Höhe nach unbeschränkt als Sonderausgaben im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung abzugsfähig sind. Für Beiträge zu einer privaten Pflegezusatzversicherung gelte dies jedoch nicht. Diese Beiträge sind nur beschränkt abzugsfähig und wirken sich häufig beim Steuerpflichtigen steuerlich nicht aus.
Im Ergebnis hatten sowohl das Veranlagungsfinanzamt im Besteuerungsverfahren als auch das Hessische Finanzgericht in 1. Instanz so entschieden.
Die Kläger waren der Auffassung, dass ein Verstoß gegen die Verfassung vorliege, wenn im Fall der Pflegebedürftigkeit, insbesondere bei stationärer Pflege, Pflegebedürftige wegen hoher Eigenanteile zu „Almosenbettlern“ degradiert würden. Der Staat müsse die Beiträge zur privaten Pflegezusatzversicherung daher zumindest steuerlich anerkennen und hierdurch eine gewisse finanzielle Entlastung der Steuerpflichtigen fördern.
Der BFH hingegen vertritt die Auffassung, dass der Gesetzgeber zunächst absichtlich lediglich eine Teilabsicherung der Bevölkerung als Vorsorge gegen Pflegebedürftigkeit vorgesehen hat. Nachdem dann erkannt worden sei, dass das umlagefinanzierte Pflegeversicherungssystem Lücken aufweise, habe der Gesetzgeber als ergänzende förderungswürdige Vorsorge die Pflegevorsorgezulage ins Leben gerufen und nicht eine private Pflegezusatzversicherung. Diese Zulage haben die Kläger aber nicht nutzen wollen, weil sie die Tarife als ungünstiger einstuften.
Es ist nach der Entscheidung des BFH jedoch verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn der Gesetzgeber lediglich den Teil steuerlich freistellt, den er als verpflichtend einstuft und dem Schutz vor der Inanspruchnahme von Sozialhilfe dienen soll.
⇑Im Ergebnis hatten sowohl das Veranlagungsfinanzamt im Besteuerungsverfahren als auch das Hessische Finanzgericht in 1. Instanz so entschieden.
Die Kläger waren der Auffassung, dass ein Verstoß gegen die Verfassung vorliege, wenn im Fall der Pflegebedürftigkeit, insbesondere bei stationärer Pflege, Pflegebedürftige wegen hoher Eigenanteile zu „Almosenbettlern“ degradiert würden. Der Staat müsse die Beiträge zur privaten Pflegezusatzversicherung daher zumindest steuerlich anerkennen und hierdurch eine gewisse finanzielle Entlastung der Steuerpflichtigen fördern.
Der BFH hingegen vertritt die Auffassung, dass der Gesetzgeber zunächst absichtlich lediglich eine Teilabsicherung der Bevölkerung als Vorsorge gegen Pflegebedürftigkeit vorgesehen hat. Nachdem dann erkannt worden sei, dass das umlagefinanzierte Pflegeversicherungssystem Lücken aufweise, habe der Gesetzgeber als ergänzende förderungswürdige Vorsorge die Pflegevorsorgezulage ins Leben gerufen und nicht eine private Pflegezusatzversicherung. Diese Zulage haben die Kläger aber nicht nutzen wollen, weil sie die Tarife als ungünstiger einstuften.
Es ist nach der Entscheidung des BFH jedoch verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn der Gesetzgeber lediglich den Teil steuerlich freistellt, den er als verpflichtend einstuft und dem Schutz vor der Inanspruchnahme von Sozialhilfe dienen soll.
Bundesfinanzhof entscheidet zur Grundsteuer im „Bundesmodell“
Der Bundesfinanzhof wird am 10.12.2025 (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) in drei Verfahren öffentlich seine Entscheidungen verkünden.
Dies ist insbesondere für Grundstückseigentümer in den Bundesländern interessant, welche die Grundsteuerreform nach dem Bundesmodell umgesetzt haben. Dies sind die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Das Saarland und Sachsen nutzen ebenfalls die Bundesregelungen mit Abweichungen bei der Steuermesszahl.
Das Bundesmodell stellt den Grundstückwert für Wohngrundstücke anhand der Grundstücks- und Wohnfläche sowie des Bodenrichtwerts, Gebäudeart und Baujahr fest. Die drei Verfahren, die zur Entscheidung anstehen, haben gemeinsam, dass die Verfassungsmäßigkeit des für Grundsteuerzwecke pauschalierten Ertragswertverfahrens streitig ist.
Das pauschalierte Ertragswertverfahren findet Anwendung auf Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke und Eigentumswohnungen. Auch für die Erbschaft- und Schenkungsteuer wird teilweise das Ertragswertverfahren angewendet, allerdings im Gegensatz zur Grundsteuer wird dort z. B. nach den tatsächlichen Nettomieten bewertet und nicht nach landeseinheitlich geltenden Nettokaltmieten. Eine Unterscheidung gibt es bei der Grundsteuer lediglich nach Gebäudeart, Baujahr und Wohnflächengruppe, die über Zu- und Abschläge zum Ausdruck gebracht werden. So findet z. B. auch keine Unterscheidung der Mietniveaustufen nach Stadtlage oder ländlicher Lage statt.
Die Frage, die der BFH zu beantworten haben wird, ist, ob es mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist, in einer Vielzahl von Grundsteuerverfahren mit einem grob vereinfachten Verfahrensansatz wie durch Gutachterausschüsse festgestellte Bodenrichtwerte und pauschalierte Nettokaltmieten den Wert eines Grundstücks bzw. einer Wohneinheit zu bestimmen.
Es sind derzeit ca. 2.000 Klageverfahren zu unterschiedlichen Grundsteuermodellen rechtshängig, beim BFH sind es 15 Verfahren.
⇑Dies ist insbesondere für Grundstückseigentümer in den Bundesländern interessant, welche die Grundsteuerreform nach dem Bundesmodell umgesetzt haben. Dies sind die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Das Saarland und Sachsen nutzen ebenfalls die Bundesregelungen mit Abweichungen bei der Steuermesszahl.
Das Bundesmodell stellt den Grundstückwert für Wohngrundstücke anhand der Grundstücks- und Wohnfläche sowie des Bodenrichtwerts, Gebäudeart und Baujahr fest. Die drei Verfahren, die zur Entscheidung anstehen, haben gemeinsam, dass die Verfassungsmäßigkeit des für Grundsteuerzwecke pauschalierten Ertragswertverfahrens streitig ist.
Das pauschalierte Ertragswertverfahren findet Anwendung auf Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke und Eigentumswohnungen. Auch für die Erbschaft- und Schenkungsteuer wird teilweise das Ertragswertverfahren angewendet, allerdings im Gegensatz zur Grundsteuer wird dort z. B. nach den tatsächlichen Nettomieten bewertet und nicht nach landeseinheitlich geltenden Nettokaltmieten. Eine Unterscheidung gibt es bei der Grundsteuer lediglich nach Gebäudeart, Baujahr und Wohnflächengruppe, die über Zu- und Abschläge zum Ausdruck gebracht werden. So findet z. B. auch keine Unterscheidung der Mietniveaustufen nach Stadtlage oder ländlicher Lage statt.
Die Frage, die der BFH zu beantworten haben wird, ist, ob es mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist, in einer Vielzahl von Grundsteuerverfahren mit einem grob vereinfachten Verfahrensansatz wie durch Gutachterausschüsse festgestellte Bodenrichtwerte und pauschalierte Nettokaltmieten den Wert eines Grundstücks bzw. einer Wohneinheit zu bestimmen.
Es sind derzeit ca. 2.000 Klageverfahren zu unterschiedlichen Grundsteuermodellen rechtshängig, beim BFH sind es 15 Verfahren.
Terminsache: Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 10.2.2026
Unternehmen, die ihre monatlichen Umsatzsteuervoranmeldungen nicht zum 10. des Folgemonats einreichen bzw. -vorauszahlungen nicht bis zum 13. des Folgemonats leisten möchten, können bis zum 10.2.2026 für das Jahr 2026 einen Antrag auf eine sog. Dauerfristverlängerung stellen. Es ist eine Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung i. H. v. einem Elftel der Umsatzsteuerzahllast des Vorjahres an das Finanzamt zu leisten. Die Umsatzsteuervoranmeldungen bzw. -zahlungen dürfen jeweils einen Monat später abgegeben bzw. gezahlt werden. Quartalszahler müssen keine Sondervorauszahlungen leisten. Die Höhe der jeweiligen Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung kann ab dem 1.1.2026 über ELSTER abgerufen werden. Die Sondervorauszahlung wird mit der Umsatzsteuervorauszahlung für Dezember verrechnet.
Achtung: Seit dem 9.10.2025 sind Banken zur Verhinderung von Online-Fehlüberweisungen und Betrug verpflichtet, den Empfängernamen mit der IBAN abzugleichen. Stimmen Empfängername und IBAN nicht überein, wird die Überweisung zunächst nicht ausgeführt. Der Kunde wird auf einen abweichenden Kontoinhaber hingewiesen und kann aktiv auswählen. Mit einer Bestätigung durch den Kunden haftet die Bank nicht mehr für Fehlüberweisungen. Dieses gilt insbesondere auch bei Echtzeitüberweisungen. Bei Papierüberweisungen gilt diese Regelung nicht.
Auf Steuerbescheiden stehen nicht immer die Empfängerangaben, sondern mitunter lediglich die IBAN. Es gilt daher, rechtzeitig den Abgleich vorzunehmen, um Zahlungsfristen nicht zu verpassen.
⇑Achtung: Seit dem 9.10.2025 sind Banken zur Verhinderung von Online-Fehlüberweisungen und Betrug verpflichtet, den Empfängernamen mit der IBAN abzugleichen. Stimmen Empfängername und IBAN nicht überein, wird die Überweisung zunächst nicht ausgeführt. Der Kunde wird auf einen abweichenden Kontoinhaber hingewiesen und kann aktiv auswählen. Mit einer Bestätigung durch den Kunden haftet die Bank nicht mehr für Fehlüberweisungen. Dieses gilt insbesondere auch bei Echtzeitüberweisungen. Bei Papierüberweisungen gilt diese Regelung nicht.
Auf Steuerbescheiden stehen nicht immer die Empfängerangaben, sondern mitunter lediglich die IBAN. Es gilt daher, rechtzeitig den Abgleich vorzunehmen, um Zahlungsfristen nicht zu verpassen.
Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge wird verlängert
Das Bundeskabinett hat am 15.10.2025 beschlossen, dass die KFZ-Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 2035 verlängert werden soll. Die erste Lesung im Bundestag hat am 14.11.2025 stattgefunden. Der Gesetzentwurf wurde zur weiteren Debatte in die Fachausschüsse verwiesen.
Die Steuerbefreiung soll für Fahrzeuge gelten, die spätestens bis zum 31.12.2030 erstmalig für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen werden. Die Steuerbefreiung gilt bis zu 10 Jahre, längstens jedoch bis zum 31.12.2035.
Die Stellungnahme des Bundesrates steht noch aus.
Ohne eines Änderung des Gesetzes wären nur noch reine Elektrofahrzeuge von der KFZ-Steuer befreit, die vor dem 1.1.2026 erstmalig zugelassen werden.
⇑Die Steuerbefreiung soll für Fahrzeuge gelten, die spätestens bis zum 31.12.2030 erstmalig für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen werden. Die Steuerbefreiung gilt bis zu 10 Jahre, längstens jedoch bis zum 31.12.2035.
Die Stellungnahme des Bundesrates steht noch aus.
Ohne eines Änderung des Gesetzes wären nur noch reine Elektrofahrzeuge von der KFZ-Steuer befreit, die vor dem 1.1.2026 erstmalig zugelassen werden.
Umsatzsteuerfreiheit für unmittelbare Schul- und Bildungsleistungen
Anfang des Jahres 2025 war eine Neuregelung zur Umsatzsteuerfreiheit für unmittelbare Schul- und Bildungsleistungen in Kraft getreten, da diese den EU-Vorgaben angepasst wurde. In der Praxis hat die Neuregelung zu Unklarheiten geführt. Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat daher am 24.10.2025 eine neue Verwaltungsanweisung mit einer Übergangsregelung veröffentlicht und diese auch der aktuellen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur Umsatzsteuerbefreiung von Bildungsleistungen angepasst.
Hiernach wird es nicht beanstandet, wenn Umsätze aus Bildungsleistungen, die vor dem 1.1.2028 ausgeführt wurden bzw. noch werden, entsprechend den bis zum 31.12.2024 geltenden Regelungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses als umsatzsteuerfrei bzw. umsatzsteuerpflichtig behandelt werden.
Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die mit der Erbringung von unmittelbaren Schul- und Bildungsleistungen betraut sind, gelten für diese Leistungen als von der Umsatzsteuer befreit. Folgende Leistungen sind demnach umsatzsteuerfrei: Schul- und Hochschulunterricht, Aus- und Fortbildung sowie berufliche Umschulung.
Für Privatlehrer wurde ein separater Befreiungstatbestand aufgenommen.
⇑Hiernach wird es nicht beanstandet, wenn Umsätze aus Bildungsleistungen, die vor dem 1.1.2028 ausgeführt wurden bzw. noch werden, entsprechend den bis zum 31.12.2024 geltenden Regelungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses als umsatzsteuerfrei bzw. umsatzsteuerpflichtig behandelt werden.
Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die mit der Erbringung von unmittelbaren Schul- und Bildungsleistungen betraut sind, gelten für diese Leistungen als von der Umsatzsteuer befreit. Folgende Leistungen sind demnach umsatzsteuerfrei: Schul- und Hochschulunterricht, Aus- und Fortbildung sowie berufliche Umschulung.
Für Privatlehrer wurde ein separater Befreiungstatbestand aufgenommen.
Deutschlandticket 2026
Das Deutschlandticket soll auch in den Jahren 2026 – 2030 erhalten bleiben. Der aktuelle Bezugspreis von 58 € in 2025 soll lt. Vereinbarung der Verkehrsminister der Bundesländer in 2026 auf 63 € monatlich steigen. Auch im Jahr 2026 können Zuschüsse zum Deutschlandticket durch den Arbeitgeber steuer- und sozialversicherungsfrei zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden. Der Zuschuss ist auf die Höhe der Aufwendungen des Arbeitnehmers begrenzt.
⇑Beitragsbemessungsgrenzen steigen ab 2026
Das Bundeskabinett hat am 8.10.2025 eine Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen für 2026 um mehr als 5 % beschlossen, die Zustimmung des Bundesrates steht noch aus. Menschen mit höherem Einkommen müssen somit, sofern sie in das gesetzliche Sozialversicherungssystem einzahlen, auf einen höheren Anteil ihres Einkommens Beiträge abführen. Diese sehen wie folgt aus:
⇑| Sozialversicherungsrechengröße | Monat | Jahr |
| Bezugsgröße in der Sozialversicherung | 3.955 € | 47.460 € |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 6 SGB V (Versicherungspflichtgrenze) in der Kranken- und Pflegeversicherung |
6.450 € | 77.400 € |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 7 SGB V (Beitragsbemessungsgrenze) in der Kranken- und Pflegeversicherung |
5.812,50 € | 69.750 € |
| Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Renten- und Arbeitslosenversicherung | 8.450 € | 101.400 € |
| Beitragsbemessungsgrenze in der knappschaftlichen Rentenversicherung | 10.400 € | 124.800 € |
| vorläufiges Durchschnittsentgelt 2026 in der Rentenversicherung |
- | 51.944 € |
| (endgültiges) Durchschnittsentgelt 2024 in der Rentenversicherung |
- | 47.085 € |
Anforderung von Unterlagen durch das Finanzamt zulässig
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu befinden, ob die Anforderung von Mietverträgen, Nebenkostenabrechnungen, Mieterhöhungsschreiben, Belegen über Erhaltungsaufwand und ähnlichen Unterlagen durch das Finanzamt bei einem Vermieter von Wohnraum zulässig ist bzw. der Vermieter die Vorlage ohne Zustimmung des Mieters verweigern darf.
Eine Vermieterin hatte die Herausgabe unter Hinweis auf die fehlende Einwilligung des Mieters und nach ihrer Auffassung daraus folgenden Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) abgelehnt. Das Finanzamt hatte die Anforderung der Unterlagen mit steuerlicher Relevanz begründet.
Der BFH entschied, dass eine Anforderung von Unterlagen zum Mietverhältnis durch das Finanzamt zwar datenschutzrechtlich relevant sei, ein Vermieter allerdings nach der Abgabenordnung zur Vorlage bei steuerlicher Relevanz verpflichtet sei, in der Regel vollständig und ungeschwärzt. Das Finanzamt müsse begründen, warum eine steuerliche Relevanz vorliege und die angeforderten Unterlagen genau bezeichnen. In diesem Fall wiege das Interesse des Finanzamtes höher als das mögliche Datenschutzinteresse eines Mieters.
Vermieter sollten demnach immer nur die konkret bezeichneten Unterlagen herausgeben, um nicht mit der DSGVO in Konflikt zu geraten.
Wichtige Unterlagen, die angefordert werden können, sind:
Mietvertrag und Mieterhöhungen
Nebenkostenabrechnungen
Belege zu Instandhaltungs- und Erhaltungsaufwand
Belege über die Mieteinnahmen, z. B. Kontoauszüge
Eine Anforderung von Unterlagen, die steuerlich nicht relevant sind, ist nicht zulässig. Das Finanzamt muss verhältnismäßig vorgehen und darf keine Ausforschung anhand beliebiger Unterlagen betreiben. Herausgaben von derart angeforderten Unterlagen sind daher nicht notwendig.
⇑Eine Vermieterin hatte die Herausgabe unter Hinweis auf die fehlende Einwilligung des Mieters und nach ihrer Auffassung daraus folgenden Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) abgelehnt. Das Finanzamt hatte die Anforderung der Unterlagen mit steuerlicher Relevanz begründet.
Der BFH entschied, dass eine Anforderung von Unterlagen zum Mietverhältnis durch das Finanzamt zwar datenschutzrechtlich relevant sei, ein Vermieter allerdings nach der Abgabenordnung zur Vorlage bei steuerlicher Relevanz verpflichtet sei, in der Regel vollständig und ungeschwärzt. Das Finanzamt müsse begründen, warum eine steuerliche Relevanz vorliege und die angeforderten Unterlagen genau bezeichnen. In diesem Fall wiege das Interesse des Finanzamtes höher als das mögliche Datenschutzinteresse eines Mieters.
Vermieter sollten demnach immer nur die konkret bezeichneten Unterlagen herausgeben, um nicht mit der DSGVO in Konflikt zu geraten.
Wichtige Unterlagen, die angefordert werden können, sind:
Mietvertrag und Mieterhöhungen
Nebenkostenabrechnungen
Belege zu Instandhaltungs- und Erhaltungsaufwand
Belege über die Mieteinnahmen, z. B. Kontoauszüge
Eine Anforderung von Unterlagen, die steuerlich nicht relevant sind, ist nicht zulässig. Das Finanzamt muss verhältnismäßig vorgehen und darf keine Ausforschung anhand beliebiger Unterlagen betreiben. Herausgaben von derart angeforderten Unterlagen sind daher nicht notwendig.
Geschenkt: Einlage des Familienheims in eine GbR
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu entscheiden, ob die Einbringung eines Familien-heims durch einen Alleineigentümer-Ehegatten in eine GbR, an der beide Ehegatten je zur Hälfte beteiligt sind, zur Festsetzung von Schenkungsteuer gegenüber dem anderen, beschenkten Ehegat-ten führt. Im notariellen Vertrag wurde die Einbringung als unentgeltliche, ehebedingte Zuwen-dung der Ehefrau an den Ehemann, den Kläger, bezeichnet. Beide Eheleute wurden als Gesell-schafter und Eigentümer des Grundstücks in das Grundbuch eingetragen.
Das Finanzamt (FA) hatte, obwohl unstreitig war, dass es sich um ein Familienheim handelte, Schenkungsteuer gegen den Kläger als Begünstigten festgesetzt. Die Voraussetzungen für das Bestehen eines Familienheims sind u. a., dass die Wohnung den Lebensmittelpunkt darstellen muss, Nutzung durch den Schenker bis zur Schenkung und anschließende Nutzung durch den Beschenkten. Zur Begründung führte das FA an, dass wegen der Übertragung der Immobilie auf die GbR die Steuerfreiheit eines Familienheims nicht anwendbar sei. Die Hälfte sei dem Kläger zuzurechnen und Schenkungsteuer zu erheben. Der Einspruch blieb erfolglos. Das erstinstanzliche Finanzgericht gab der Klage statt und änderte die Schenkungsteuer auf 0 € mit der Begründung, dass auch der Erwerb von Gesamthandseigentum steuerfrei als Familienheim möglich sei. Der BFH sah die Revision des FA als unbegründet an und wies sie zurück.
Nach Auffassung des BFH ist bei einer GbR der einzelne Gesellschafter Steuerschuldner und nicht die Gesamthandgemeinschaft, obwohl die GbR teilrechts- und eintragungsfähig ist. Demnach ist ein bebautes Grundstück auch ein Familienheim, welches den inneren Kern der Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft eines Paares betrifft. Dieses hat der Gesetzgeber ausdrücklich privilegiert und steuerfrei gestellt.
⇑Das Finanzamt (FA) hatte, obwohl unstreitig war, dass es sich um ein Familienheim handelte, Schenkungsteuer gegen den Kläger als Begünstigten festgesetzt. Die Voraussetzungen für das Bestehen eines Familienheims sind u. a., dass die Wohnung den Lebensmittelpunkt darstellen muss, Nutzung durch den Schenker bis zur Schenkung und anschließende Nutzung durch den Beschenkten. Zur Begründung führte das FA an, dass wegen der Übertragung der Immobilie auf die GbR die Steuerfreiheit eines Familienheims nicht anwendbar sei. Die Hälfte sei dem Kläger zuzurechnen und Schenkungsteuer zu erheben. Der Einspruch blieb erfolglos. Das erstinstanzliche Finanzgericht gab der Klage statt und änderte die Schenkungsteuer auf 0 € mit der Begründung, dass auch der Erwerb von Gesamthandseigentum steuerfrei als Familienheim möglich sei. Der BFH sah die Revision des FA als unbegründet an und wies sie zurück.
Nach Auffassung des BFH ist bei einer GbR der einzelne Gesellschafter Steuerschuldner und nicht die Gesamthandgemeinschaft, obwohl die GbR teilrechts- und eintragungsfähig ist. Demnach ist ein bebautes Grundstück auch ein Familienheim, welches den inneren Kern der Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft eines Paares betrifft. Dieses hat der Gesetzgeber ausdrücklich privilegiert und steuerfrei gestellt.
Workation: Was Arbeitgeber und Arbeitnehmer beachten müssen
Ermöglichen in Deutschland ansässige Unternehmen ihrer Belegschaft das kurzfristige mobile Arbeiten aus dem Ausland, auch Workation genannt, ist dies für viele Jobsuchende eines von mehreren Kriterien, sich für oder gegen eine Arbeitsaufnahme in dem betreffenden Unternehmen oder für einen Jobwechsel zu entscheiden. Mittlerweile erwarten laut einer Workation-Studie deutlich mehr als die Hälfte der Beschäftigten von ihren Arbeitgebern, dass mobiles Arbeiten nicht nur im Inland, sondern auch aus dem Ausland ermöglicht wird.
Gleichwohl sind sowohl die Unternehmen als auch die Beschäftigten oft nicht hinreichend über die rechtlichen und steuerlichen Voraussetzungen und Folgen informiert. In den Arbeitsverträgen und Zusatzvereinbarungen finden sich häufig keine rechtssicheren Vereinbarungen.
Deutlich definierte Regelungen sind allein aus Haftungsgründen sehr wichtig. Die Unternehmen sollten daher steuer-, arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Regelungen vorab prüfen bzw. prüfen lassen. Workation ist deutlich abzugrenzen von einer dauerhaften Tätigkeit im Ausland für das Unternehmen, aber auch die Arbeit in einer ausländischen Niederlassung eines deutschen Unternehmens stellt keine Workation dar.
Folgende Punkte sollten vorab geklärt bzw. vertraglich vereinbart werden:
Achtung: Wer ohne Arbeitserlaubnis arbeitet, gilt als illegal beschäftigt, kann ggf. ausgewiesen und mit Einreiseverboten belegt werden. Für den Arbeitgeber kann ein derartiges Vorgehen zu einer Gewerbeuntersagung mit hohen Bußgeldern führen.
Die Beachtung der sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen und Folgen sind ebenfalls wichtig.
Wenn ein Arbeitgeber einer Workation im EU-Ausland zustimmt, gilt dieser Umstand sozialversicherungsrechtlich als Entsendung. Der Arbeitgeber verpflichtet sich damit, für das Bestehen eines Krankenversicherungsschutzes seiner Mitarbeiter und der mitreisenden Familienangehörigen zu haften bzw. dafür Sorge zu tragen, dass dieser besteht.
Die vorübergehende Entsendung eines Mitarbeiters aus Deutschland im Auftrag des inländischen Unternehmens in das europäische Ausland muss im Voraus zeitlich befristet sein. Das Entgelt muss in Deutschland abgerechnet werden. Eine Auslandsentsendung liegt nicht vor, wenn die entsandte Person im Ausland lebt und von einem deutschen Unternehmen für eine Tätigkeit in ihrem Heimatstaat oder einem anderen Land eingestellt wird. Die Person darf vor der Tätigkeit nicht in Deutschland beschäftigt gewesen sein oder zuvor in Deutschland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt gehabt haben.
⇑Gleichwohl sind sowohl die Unternehmen als auch die Beschäftigten oft nicht hinreichend über die rechtlichen und steuerlichen Voraussetzungen und Folgen informiert. In den Arbeitsverträgen und Zusatzvereinbarungen finden sich häufig keine rechtssicheren Vereinbarungen.
Deutlich definierte Regelungen sind allein aus Haftungsgründen sehr wichtig. Die Unternehmen sollten daher steuer-, arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Regelungen vorab prüfen bzw. prüfen lassen. Workation ist deutlich abzugrenzen von einer dauerhaften Tätigkeit im Ausland für das Unternehmen, aber auch die Arbeit in einer ausländischen Niederlassung eines deutschen Unternehmens stellt keine Workation dar.
Folgende Punkte sollten vorab geklärt bzw. vertraglich vereinbart werden:
- Innerbetriebliche Regelungen sollten klarstellen, welche Beschäftigungsgruppen das Workation-Angebot nutzen können.
- Bei einer vorübergehenden Workation bis zu 4 Wochen gilt deutsches Arbeitsrecht, Feiertage am Arbeitsort gelten auch für den Beschäftigten.
- Bei einer länger als 4 Wochen andauernden Workation muss das Unternehmen den Beschäftigten einen schriftlichen Nachweis hierüber sowie weitere Angaben aushändigen, z. B. über die Dauer des Aufenthalts und die Währung, in der das Arbeitsentgelt gezahlt wird (Nachweisgesetz).
- Bei einer mehr als 6 Monate andauernden Workation gilt das Arbeitsrecht des Workation-Landes im Hinblick auf Entlohnung, Kündigungsfristen, Arbeitszeiten und Urlaubsansprüche.
- Längere Workation in Nicht-EU-Ländern führen i. d. R. zur Notwendigkeit eines Visums, ein Touristenvisum ist nicht ausreichend. Ggf. ist ein Arbeits- oder spezielles Workationsvisum zu beantragen, welches es in einigen Ländern bereits gibt.
Achtung: Wer ohne Arbeitserlaubnis arbeitet, gilt als illegal beschäftigt, kann ggf. ausgewiesen und mit Einreiseverboten belegt werden. Für den Arbeitgeber kann ein derartiges Vorgehen zu einer Gewerbeuntersagung mit hohen Bußgeldern führen.
- Innerhalb der EU, der EWR und der Schweiz können Beschäftigte sich zu Arbeitszwecken uneingeschränkt aufhalten. Ein Visum wird nicht benötigt. Allerdings sind in den meisten Ländern Melde- oder Registrierpflichten zu beachten.
- Wer max. 183 Tage im Jahr im Ausland arbeitet, bleibt in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, bei längerem Aufenthalt entsteht die Steuerpflicht im Ausland.
- Dauert eine Workation länger als 4 Wochen, muss insbesondere der Arbeitgeber arbeits- und steuerrechtliche Folgen beachten. Hierüber sollte der Arbeitgeber sich auch immer selbstständig informieren.
Die Beachtung der sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen und Folgen sind ebenfalls wichtig.
- Bei einer Workation im Drittland - außerhalb der EU - muss geprüft werden, ob zwischen Deutschland und dem jeweiligen Staat ein Sozialversicherungsabkommen besteht. Diese Information sollte rechtzeitig eingeholt werden. Beratung bzw. Rücksprache mit einer Fachkraft in Auslandsentsendungsfragen ist hier hilfreich.
- Bei einer Workation innerhalb der EU, EWR oder Schweiz benötigt der Arbeitnehmer eine sog. A1-Bescheinigung, die dem Nachweis der Versicherungszugehörigkeit dient und elektronisch vom Arbeitgeber oder Arbeitnehmer beantragt werden kann.
- Zu beachten ist, dass auch Grenzgänger seit 2025 eine solche A1-Bescheinigung benötigen, selbst wenn keine Workation stattfindet.
Wenn ein Arbeitgeber einer Workation im EU-Ausland zustimmt, gilt dieser Umstand sozialversicherungsrechtlich als Entsendung. Der Arbeitgeber verpflichtet sich damit, für das Bestehen eines Krankenversicherungsschutzes seiner Mitarbeiter und der mitreisenden Familienangehörigen zu haften bzw. dafür Sorge zu tragen, dass dieser besteht.
Die vorübergehende Entsendung eines Mitarbeiters aus Deutschland im Auftrag des inländischen Unternehmens in das europäische Ausland muss im Voraus zeitlich befristet sein. Das Entgelt muss in Deutschland abgerechnet werden. Eine Auslandsentsendung liegt nicht vor, wenn die entsandte Person im Ausland lebt und von einem deutschen Unternehmen für eine Tätigkeit in ihrem Heimatstaat oder einem anderen Land eingestellt wird. Die Person darf vor der Tätigkeit nicht in Deutschland beschäftigt gewesen sein oder zuvor in Deutschland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt gehabt haben.
Bundesfinanzhof entscheidet zur Grundsteuer im „Bundesmodell“
Der Bundesfinanzhof wird am 10.12.2025 (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) in drei Verfahren öffentlich seine Entscheidungen verkünden.
Dies ist insbesondere für Grundstückseigentümer in den Bundesländern interessant, welche die Grundsteuerreform nach dem Bundesmodell umgesetzt haben. Dies sind die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Das Saarland und Sachsen nutzen ebenfalls die Bundesregelungen mit Abweichungen bei der Steuermesszahl.
Das Bundesmodell stellt den Grundstückwert für Wohngrundstücke anhand der Grundstücks- und Wohnfläche sowie des Bodenrichtwerts, Gebäudeart und Baujahr fest. Die drei Verfahren, die zur Entscheidung anstehen, haben gemeinsam, dass die Verfassungsmäßigkeit des für Grundsteuerzwecke pauschalierten Ertragswertverfahrens streitig ist.
Das pauschalierte Ertragswertverfahren findet Anwendung auf Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke und Eigentumswohnungen. Auch für die Erbschaft- und Schenkungsteuer wird teilweise das Ertragswertverfahren angewendet, allerdings im Gegensatz zur Grundsteuer wird dort z. B. nach den tatsächlichen Nettomieten bewertet und nicht nach landeseinheitlich geltenden Nettokaltmieten. Eine Unterscheidung gibt es bei der Grundsteuer lediglich nach Gebäudeart, Baujahr und Wohnflächengruppe, die über Zu- und Abschläge zum Ausdruck gebracht werden. So findet z. B. auch keine Unterscheidung der Mietniveaustufen nach Stadtlage oder ländlicher Lage statt.
Die Frage, die der BFH zu beantworten haben wird, ist, ob es mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist, in einer Vielzahl von Grundsteuerverfahren mit einem grob vereinfachten Verfahrensansatz wie durch Gutachterausschüsse festgestellte Bodenrichtwerte und pauschalierte Nettokaltmieten den Wert eines Grundstücks bzw. einer Wohneinheit zu bestimmen.
Es sind derzeit ca. 2.000 Klageverfahren zu unterschiedlichen Grundsteuermodellen rechtshängig, beim BFH sind es 15 Verfahren.
⇑Dies ist insbesondere für Grundstückseigentümer in den Bundesländern interessant, welche die Grundsteuerreform nach dem Bundesmodell umgesetzt haben. Dies sind die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Das Saarland und Sachsen nutzen ebenfalls die Bundesregelungen mit Abweichungen bei der Steuermesszahl.
Das Bundesmodell stellt den Grundstückwert für Wohngrundstücke anhand der Grundstücks- und Wohnfläche sowie des Bodenrichtwerts, Gebäudeart und Baujahr fest. Die drei Verfahren, die zur Entscheidung anstehen, haben gemeinsam, dass die Verfassungsmäßigkeit des für Grundsteuerzwecke pauschalierten Ertragswertverfahrens streitig ist.
Das pauschalierte Ertragswertverfahren findet Anwendung auf Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke und Eigentumswohnungen. Auch für die Erbschaft- und Schenkungsteuer wird teilweise das Ertragswertverfahren angewendet, allerdings im Gegensatz zur Grundsteuer wird dort z. B. nach den tatsächlichen Nettomieten bewertet und nicht nach landeseinheitlich geltenden Nettokaltmieten. Eine Unterscheidung gibt es bei der Grundsteuer lediglich nach Gebäudeart, Baujahr und Wohnflächengruppe, die über Zu- und Abschläge zum Ausdruck gebracht werden. So findet z. B. auch keine Unterscheidung der Mietniveaustufen nach Stadtlage oder ländlicher Lage statt.
Die Frage, die der BFH zu beantworten haben wird, ist, ob es mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist, in einer Vielzahl von Grundsteuerverfahren mit einem grob vereinfachten Verfahrensansatz wie durch Gutachterausschüsse festgestellte Bodenrichtwerte und pauschalierte Nettokaltmieten den Wert eines Grundstücks bzw. einer Wohneinheit zu bestimmen.
Es sind derzeit ca. 2.000 Klageverfahren zu unterschiedlichen Grundsteuermodellen rechtshängig, beim BFH sind es 15 Verfahren.
Terminsache: Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 10.2.2026
Unternehmen, die ihre monatlichen Umsatzsteuervoranmeldungen nicht zum 10. des Folgemonats einreichen bzw. -vorauszahlungen nicht bis zum 13. des Folgemonats leisten möchten, können bis zum 10.2.2026 für das Jahr 2026 einen Antrag auf eine sog. Dauerfristverlängerung stellen. Es ist eine Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung i. H. v. einem Elftel der Umsatzsteuerzahllast des Vorjahres an das Finanzamt zu leisten. Die Umsatzsteuervoranmeldungen bzw. -zahlungen dürfen jeweils einen Monat später abgegeben bzw. gezahlt werden. Quartalszahler müssen keine Sondervorauszahlungen leisten. Die Höhe der jeweiligen Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung kann ab dem 1.1.2026 über ELSTER abgerufen werden. Die Sondervorauszahlung wird mit der Umsatzsteuervorauszahlung für Dezember verrechnet.
Achtung: Seit dem 9.10.2025 sind Banken zur Verhinderung von Online-Fehlüberweisungen und Betrug verpflichtet, den Empfängernamen mit der IBAN abzugleichen. Stimmen Empfängername und IBAN nicht überein, wird die Überweisung zunächst nicht ausgeführt. Der Kunde wird auf einen abweichenden Kontoinhaber hingewiesen und kann aktiv auswählen. Mit einer Bestätigung durch den Kunden haftet die Bank nicht mehr für Fehlüberweisungen. Dieses gilt insbesondere auch bei Echtzeitüberweisungen. Bei Papierüberweisungen gilt diese Regelung nicht.
Auf Steuerbescheiden stehen nicht immer die Empfängerangaben, sondern mitunter lediglich die IBAN. Es gilt daher, rechtzeitig den Abgleich vorzunehmen, um Zahlungsfristen nicht zu verpassen.
⇑Achtung: Seit dem 9.10.2025 sind Banken zur Verhinderung von Online-Fehlüberweisungen und Betrug verpflichtet, den Empfängernamen mit der IBAN abzugleichen. Stimmen Empfängername und IBAN nicht überein, wird die Überweisung zunächst nicht ausgeführt. Der Kunde wird auf einen abweichenden Kontoinhaber hingewiesen und kann aktiv auswählen. Mit einer Bestätigung durch den Kunden haftet die Bank nicht mehr für Fehlüberweisungen. Dieses gilt insbesondere auch bei Echtzeitüberweisungen. Bei Papierüberweisungen gilt diese Regelung nicht.
Auf Steuerbescheiden stehen nicht immer die Empfängerangaben, sondern mitunter lediglich die IBAN. Es gilt daher, rechtzeitig den Abgleich vorzunehmen, um Zahlungsfristen nicht zu verpassen.
Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge wird verlängert
Das Bundeskabinett hat am 15.10.2025 beschlossen, dass die KFZ-Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 2035 verlängert werden soll. Die erste Lesung im Bundestag hat am 14.11.2025 stattgefunden. Der Gesetzentwurf wurde zur weiteren Debatte in die Fachausschüsse verwiesen.
Die Steuerbefreiung soll für Fahrzeuge gelten, die spätestens bis zum 31.12.2030 erstmalig für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen werden. Die Steuerbefreiung gilt bis zu 10 Jahre, längstens jedoch bis zum 31.12.2035.
Die Stellungnahme des Bundesrates steht noch aus.
Ohne eines Änderung des Gesetzes wären nur noch reine Elektrofahrzeuge von der KFZ-Steuer befreit, die vor dem 1.1.2026 erstmalig zugelassen werden.
⇑Die Steuerbefreiung soll für Fahrzeuge gelten, die spätestens bis zum 31.12.2030 erstmalig für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen werden. Die Steuerbefreiung gilt bis zu 10 Jahre, längstens jedoch bis zum 31.12.2035.
Die Stellungnahme des Bundesrates steht noch aus.
Ohne eines Änderung des Gesetzes wären nur noch reine Elektrofahrzeuge von der KFZ-Steuer befreit, die vor dem 1.1.2026 erstmalig zugelassen werden.
Sonderabschreibung: Neuer Ersatzbau = Neubau?
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat Ende Oktober 2025 ein bereits seit längerer Zeit erwartetes Urteil vom 12.8.2025 zur Sonderabschreibungsmöglichkeit von Mietwohnungsneubau veröffentlicht.
Im Klageverfahren ging es um einen ersten Förderzeitraum, für den die Wohnungsherstellung durch Bauantrag oder Bauanzeige nach dem 31.8.2018, aber vor dem 1.1.2022 begann. Aktuell gibt es einen zweiten Förderzeitraum für Bauanträge oder Bauanzeigen über Wohnungsherstellungen, die nach dem 31.12.2022, aber vor dem 1.10.2029 begannen.
Die Kläger hatten im ersten Förderzeitraum ein vermietetes, nutzbares Einfamilienhaus nach Kündigung und Auszug der Mieter abgerissen, weil eine behördliche Aufforderung zur Sanierung der Abwasserrohre erfolgt war. Auf dem Grundstück wurde ebenfalls wieder ein Einfamilienhaus errichtet, über welches auch ein Mietvertrag mit Mietern abgeschlossen wurde. Das Finanzamt wollte die von den Klägern geltend gemachte Sonderabschreibung nicht als Werbungskosten anerkennen, da es sich zwar um einen Neubau handelte, aber kein zusätzlicher Wohnraum geschaffen worden sei. Abriss und Neubau erfolgten innerhalb eines Zeitraumes von ca. 1,5 Jahren.
Weder die Gesetzesbegründung noch die Finanzverwaltung äußerten sich im Vorfeld bzw. im Nachgang des Gesetzgebungsverfahrens dazu, ob die Formulierung „neue, bisher nicht vorhandene Wohnung hergestellt“ so zu verstehen sei, dass ein neuer Ersatzbau, der keinen zusätzlichen Wohnraum schaffe, auch nicht förderfähig sei oder ob eine Rückschau auf das abgerissene Gebäude relevant sei, womöglich durch einen Wohnflächenvergleich und Gebäudeart vor und nach dem Abriss.
Sowohl das erstinstanzliche Finanzgericht Köln als auch der BFH haben die Fördervoraussetzungen für die Sonderabschreibung als nicht gegeben angesehen.
Der BFH stellte in seiner Entscheidung im Wesentlichen darauf ab, dass ein Ersetzen vorhandener Wohnungen durch einen gleichartigen Neubau keine „neue, bisher nicht vorhandene Wohnung“ darstelle. Dies könne allerdings anders sein, wenn der Abriss und der Neubau einer Wohnung nicht im zeitlichen Zusammenhang stehen wie im zu entscheidenden Fall.
Sinn und Zweck der Norm und der Förderung sei es, eine Vermehrung von Wohnraum zu erreichen und diesen nicht lediglich zu ersetzen. Mit der Förderung durch die Sonderabschreibung sollte der Wohnungsknappheit entgegengewirkt werden.
Im aktuellen zweiten Förderzeitraum, über den im Urteil nicht zu entscheiden war, heißt es nur noch „neue“ Wohnung mit den Kriterien des „Effizienzhaus 40“ mit Nachhaltigkeitsfaktor.
Der BFH hat in seiner Entscheidung allerdings bereits anklingen lassen, dass auch hier die gleichen Parameter gelten könnten.
Insoweit dürfte, wenn weder die Finanzverwaltung noch der Gesetzgeber klärend eingreifen, mit einer Vielzahl an Klageverfahren zu rechnen sein.
Betroffene Steuerpflichtige sollten sich umgehend steuerlich beraten lassen, wenn das zuständige Finanzamt die Sonderabschreibung nicht anerkannt hat.
⇑Im Klageverfahren ging es um einen ersten Förderzeitraum, für den die Wohnungsherstellung durch Bauantrag oder Bauanzeige nach dem 31.8.2018, aber vor dem 1.1.2022 begann. Aktuell gibt es einen zweiten Förderzeitraum für Bauanträge oder Bauanzeigen über Wohnungsherstellungen, die nach dem 31.12.2022, aber vor dem 1.10.2029 begannen.
Die Kläger hatten im ersten Förderzeitraum ein vermietetes, nutzbares Einfamilienhaus nach Kündigung und Auszug der Mieter abgerissen, weil eine behördliche Aufforderung zur Sanierung der Abwasserrohre erfolgt war. Auf dem Grundstück wurde ebenfalls wieder ein Einfamilienhaus errichtet, über welches auch ein Mietvertrag mit Mietern abgeschlossen wurde. Das Finanzamt wollte die von den Klägern geltend gemachte Sonderabschreibung nicht als Werbungskosten anerkennen, da es sich zwar um einen Neubau handelte, aber kein zusätzlicher Wohnraum geschaffen worden sei. Abriss und Neubau erfolgten innerhalb eines Zeitraumes von ca. 1,5 Jahren.
Weder die Gesetzesbegründung noch die Finanzverwaltung äußerten sich im Vorfeld bzw. im Nachgang des Gesetzgebungsverfahrens dazu, ob die Formulierung „neue, bisher nicht vorhandene Wohnung hergestellt“ so zu verstehen sei, dass ein neuer Ersatzbau, der keinen zusätzlichen Wohnraum schaffe, auch nicht förderfähig sei oder ob eine Rückschau auf das abgerissene Gebäude relevant sei, womöglich durch einen Wohnflächenvergleich und Gebäudeart vor und nach dem Abriss.
Sowohl das erstinstanzliche Finanzgericht Köln als auch der BFH haben die Fördervoraussetzungen für die Sonderabschreibung als nicht gegeben angesehen.
Der BFH stellte in seiner Entscheidung im Wesentlichen darauf ab, dass ein Ersetzen vorhandener Wohnungen durch einen gleichartigen Neubau keine „neue, bisher nicht vorhandene Wohnung“ darstelle. Dies könne allerdings anders sein, wenn der Abriss und der Neubau einer Wohnung nicht im zeitlichen Zusammenhang stehen wie im zu entscheidenden Fall.
Sinn und Zweck der Norm und der Förderung sei es, eine Vermehrung von Wohnraum zu erreichen und diesen nicht lediglich zu ersetzen. Mit der Förderung durch die Sonderabschreibung sollte der Wohnungsknappheit entgegengewirkt werden.
Im aktuellen zweiten Förderzeitraum, über den im Urteil nicht zu entscheiden war, heißt es nur noch „neue“ Wohnung mit den Kriterien des „Effizienzhaus 40“ mit Nachhaltigkeitsfaktor.
Der BFH hat in seiner Entscheidung allerdings bereits anklingen lassen, dass auch hier die gleichen Parameter gelten könnten.
Insoweit dürfte, wenn weder die Finanzverwaltung noch der Gesetzgeber klärend eingreifen, mit einer Vielzahl an Klageverfahren zu rechnen sein.
Betroffene Steuerpflichtige sollten sich umgehend steuerlich beraten lassen, wenn das zuständige Finanzamt die Sonderabschreibung nicht anerkannt hat.
Beitragsbemessungsgrenzen steigen ab 2026
Das Bundeskabinett hat am 8.10.2025 eine Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen für 2026 um mehr als 5 % beschlossen, die Zustimmung des Bundesrates steht noch aus. Menschen mit höherem Einkommen müssen somit, sofern sie in das gesetzliche Sozialversicherungssystem einzahlen, auf einen höheren Anteil ihres Einkommens Beiträge abführen. Diese sehen wie folgt aus:
⇑| Sozialversicherungsrechengröße | Monat | Jahr |
| Bezugsgröße in der Sozialversicherung | 3.955 € | 47.460 € |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 6 SGB V (Versicherungspflichtgrenze) in der Kranken- und Pflegeversicherung |
6.450 € | 77.400 € |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 7 SGB V (Beitragsbemessungsgrenze) in der Kranken- und Pflegeversicherung |
5.812,50 € | 69.750 € |
| Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Renten- und Arbeitslosenversicherung | 8.450 € | 101.400 € |
| Beitragsbemessungsgrenze in der knappschaftlichen Rentenversicherung | 10.400 € | 124.800 € |
| vorläufiges Durchschnittsentgelt 2026 in der Rentenversicherung |
- | 51.944 € |
| (endgültiges) Durchschnittsentgelt 2024 in der Rentenversicherung |
- | 47.085 € |
Neue Sachbezugswerte 2026 für Unterkunft und Verpflegung
Unentgeltliche bzw. vergünstigte Mahlzeiten des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer sind als geldwerter Vorteil den Arbeitnehmern im Rahmen des Arbeitsverhältnisses zuzurechnen und zu versteuern.
Die Sachbezugswerte werden sich nach dem Referentenentwurf der Sozialversicherungsentgeltverordnung vom 8.10.2025 zum 1.1.2026 voraussichtlich erhöhen. Verabschiedet werden soll die Änderung nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe. Danach sehen die Sachbezugswerte wie folgt aus:
Diese Regelungen gelten auch für Mahlzeiten, die Arbeitnehmern während einer dienstlich veranlassten Auswärtstätigkeit oder bei doppelter Haushaltsführung zur Verfügung gestellt bzw. zugerechnet werden, wenn der Preis der Mahlzeit 60 € nicht übersteigt. Sonst stellt der Wert der Mahlzeit insgesamt einen geldwerten Vorteil dar.
Stellt der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer kostenlos oder vergünstigt eine Unterkunft zur Verfügung, wird wie folgt unterschieden, wobei bei Wohnungsüberlassung hiervon abweichend im Zweifel die ortsübliche Miete als Sachbezug anzusetzen ist:
* je nach Belegung
⇑Die Sachbezugswerte werden sich nach dem Referentenentwurf der Sozialversicherungsentgeltverordnung vom 8.10.2025 zum 1.1.2026 voraussichtlich erhöhen. Verabschiedet werden soll die Änderung nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe. Danach sehen die Sachbezugswerte wie folgt aus:
| Steuerfreier Sachbezug: Mahlzeiten bis 60 € (Inland) | ||
| 2025 | 2026 | |
| Frühstück | 2,30 €/Mahlzeit | 2,37 €/Mahlzeit |
| Mittag-/ Abendessen | 4,40 €/Mahlzeit | 4,57 €/Mahlzeit |
| Vollverpflegung | 11,10 €/Tag bzw. 333 €/Monat |
11,51 €/Tag bzw. 345 €/Monat |
Diese Regelungen gelten auch für Mahlzeiten, die Arbeitnehmern während einer dienstlich veranlassten Auswärtstätigkeit oder bei doppelter Haushaltsführung zur Verfügung gestellt bzw. zugerechnet werden, wenn der Preis der Mahlzeit 60 € nicht übersteigt. Sonst stellt der Wert der Mahlzeit insgesamt einen geldwerten Vorteil dar.
Stellt der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer kostenlos oder vergünstigt eine Unterkunft zur Verfügung, wird wie folgt unterschieden, wobei bei Wohnungsüberlassung hiervon abweichend im Zweifel die ortsübliche Miete als Sachbezug anzusetzen ist:
| Unterkunft des Arbeitgebers | ||
| 2025 | 2026 | |
| allg. Unterkunft Einzelnutzung durch Volljährige |
282 €/Monat | 285 €/Monat |
| Gemeinschaftsunterkunft Volljährige |
112,80 – 169,20 €/Monat* | 114 – 171 €/Monat* |
| Einzelnutzung durch Jugendliche / Azubis |
239,70 €/Monat | 242,25 €/Monat |
| Gemeinschaftsunterkunft Jugendliche/Azubis | 70,50 € – 126,90 €/Monat* | 71,25 – 128,25 €/Monat* |
E-Fahrzeuge am Arbeitsplatz aufladen
Eine weitere steuerliche Förderung zugunsten der Elektromobilität betrifft auch das Aufladen des E-Firmenwagens beim Arbeitnehmer zu Hause bzw. das Aufladen des privaten Elektro-PKW des Arbeitnehmers im Betrieb des Arbeitgebers. Hierbei werden sowohl reine Elektrofahrzeuge als auch Hybridfahrzeuge begünstigt.
Das kostenlose oder verbilligte Aufladen eines E-Fahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers oder das Überlassen eines Ladepunktes beim Arbeitnehmer zu Hause durch den Arbeitgeber ist, obwohl es sich um eine unentgeltliche Wertabgabe handelt und eigentlich einen steuerpflichtigen Vorgang darstellt, steuerfrei, wenn der Vorteil zusätzlich zum geschuldeten Lohn bzw. Gehalt gewährt wird. Es besteht dann auch Sozialversicherungsfreiheit.
Wer als Arbeitnehmer z. B. einen Firmenwagen fährt und seinen geldwerten Vorteil anhand der Fahrtenbuchmethode ermittelt, kann die Stromkosten herausrechnen, sodass der geldwerte Vorteil geringer ausfällt.
Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern eine betriebliche Wallbox nebst Zubehör und Einbau im Arbeitnehmerhaushalt zum Aufladen reiner Elektro- oder Hybridfahrzeuge überlassen. Sofern diese Eigentum des Arbeitgebers bleiben, ist diese Überlassung steuerfrei.
Sofern Zuschüsse zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für den Erwerb und die Nutzung einer Wallbox durch den Arbeitgeber gewährt werden, die Eigentum des Arbeitnehmers ist bzw. wird, ist eine Pauschalversteuerung von 25 % möglich.
Begünstigt ist auch das Aufladen privater reiner E- und Hybridfahrzeuge des Arbeitnehmers an Ladepunkten des Arbeitgebers beim Arbeitgeber.
Die Steuerfreiheit gilt zumindest bis zum Jahr 2030, sowohl für eigene Ladesäulen des Arbeitgebers als auch solche fremder Unternehmen auf dem Grundstück des Arbeitgebers, deren Kosten der Arbeitgeber trägt. Für vom Arbeitgeber angemietete Grundstücke gilt bei ansonsten gleicher Konstellation dieselbe Regelung.
Für Leiharbeitnehmer im Betrieb des Entleihers gilt die Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit bei privaten reinen E- und Hybridfahrzeugen ebenso.
Eigentlich müsste über die Aufladungen von auch zur privaten Nutzung überlassenen E-Dienstwagen, die beim Arbeitnehmer zuhause erfolgen, Aufzeichnungen angefertigt werden.
Zur Vereinfachung für die Erstattung des Auslagenersatzes durch den Arbeitgeber an den Arbeitnehmer bei der privaten Aufladung von Elektrodienstwagen gelten gemäß BMF-Schreiben folgende monatliche Pauschalen:
reines E-Fahrzeug ja 30 €
Hybridfahrzeug ja 15 €
reines E-Fahrzeug nein 70 €
Hybridfahrzeug nein 35 €
Mit Zahlung der Auslagenpauschale durch den Arbeitgeber sind sämtliche Ladekosten abgegolten. Sofern die tatsächlichen Kosten die o. g. Pauschalen übersteigen, können sie anhand von Belegen in tatsächlicher Höhe dem Arbeitnehmer als steuerfreier Auslagenersatz durch den Arbeitgeber erstattet werden. Erstattet der Arbeitgeber die Kosten des Ladestroms nicht, so vermindert sich der geldwerte Vorteil des Arbeitnehmers um die nachgewiesenen Kosten.
Die Erstattung von Ladestromkosten für ein privates E-Fahrzeug eines Arbeitnehmers an dessen privater Ladestation zuhause durch den Arbeitgeber ist steuer- und beitragsfrei nicht möglich, sondern stellt steuerpflichtigen Arbeitslohn dar.
Für dienstlich veranlasste Fahrten mit dem privaten E-Fahrzeug, welches an einer privaten E-Ladesäule aufgeladen wurde, bleibt es bei der für den Arbeitnehmer steuer- und beitragsfreien Erstattung der üblichen km-Pauschalen durch den Arbeitgeber.
Hinweis: Die unentgeltliche Wertabgabe muss durch den Arbeitgeber umsatzsteuerlich jedoch berücksichtigt werden.
⇑Das kostenlose oder verbilligte Aufladen eines E-Fahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers oder das Überlassen eines Ladepunktes beim Arbeitnehmer zu Hause durch den Arbeitgeber ist, obwohl es sich um eine unentgeltliche Wertabgabe handelt und eigentlich einen steuerpflichtigen Vorgang darstellt, steuerfrei, wenn der Vorteil zusätzlich zum geschuldeten Lohn bzw. Gehalt gewährt wird. Es besteht dann auch Sozialversicherungsfreiheit.
Wer als Arbeitnehmer z. B. einen Firmenwagen fährt und seinen geldwerten Vorteil anhand der Fahrtenbuchmethode ermittelt, kann die Stromkosten herausrechnen, sodass der geldwerte Vorteil geringer ausfällt.
Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern eine betriebliche Wallbox nebst Zubehör und Einbau im Arbeitnehmerhaushalt zum Aufladen reiner Elektro- oder Hybridfahrzeuge überlassen. Sofern diese Eigentum des Arbeitgebers bleiben, ist diese Überlassung steuerfrei.
Sofern Zuschüsse zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für den Erwerb und die Nutzung einer Wallbox durch den Arbeitgeber gewährt werden, die Eigentum des Arbeitnehmers ist bzw. wird, ist eine Pauschalversteuerung von 25 % möglich.
Begünstigt ist auch das Aufladen privater reiner E- und Hybridfahrzeuge des Arbeitnehmers an Ladepunkten des Arbeitgebers beim Arbeitgeber.
Die Steuerfreiheit gilt zumindest bis zum Jahr 2030, sowohl für eigene Ladesäulen des Arbeitgebers als auch solche fremder Unternehmen auf dem Grundstück des Arbeitgebers, deren Kosten der Arbeitgeber trägt. Für vom Arbeitgeber angemietete Grundstücke gilt bei ansonsten gleicher Konstellation dieselbe Regelung.
Für Leiharbeitnehmer im Betrieb des Entleihers gilt die Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit bei privaten reinen E- und Hybridfahrzeugen ebenso.
Eigentlich müsste über die Aufladungen von auch zur privaten Nutzung überlassenen E-Dienstwagen, die beim Arbeitnehmer zuhause erfolgen, Aufzeichnungen angefertigt werden.
Zur Vereinfachung für die Erstattung des Auslagenersatzes durch den Arbeitgeber an den Arbeitnehmer bei der privaten Aufladung von Elektrodienstwagen gelten gemäß BMF-Schreiben folgende monatliche Pauschalen:
| Fahrzeugtyp | Lademöglichkeit zusätzlich beim Arbeitgeber oder Stromtankkarte | Auslagenerstattung durch Arbeitgeber pauschal steuer- und beitragsfrei |
| reines E-Fahrzeug | ja | 30 € |
| Hybridfahrzeug | ja | 15 € |
| reines E-Fahrzeug | nein | 70 € |
| Hybridfahrzeug | nein | 35 € |
reines E-Fahrzeug ja 30 €
Hybridfahrzeug ja 15 €
reines E-Fahrzeug nein 70 €
Hybridfahrzeug nein 35 €
Mit Zahlung der Auslagenpauschale durch den Arbeitgeber sind sämtliche Ladekosten abgegolten. Sofern die tatsächlichen Kosten die o. g. Pauschalen übersteigen, können sie anhand von Belegen in tatsächlicher Höhe dem Arbeitnehmer als steuerfreier Auslagenersatz durch den Arbeitgeber erstattet werden. Erstattet der Arbeitgeber die Kosten des Ladestroms nicht, so vermindert sich der geldwerte Vorteil des Arbeitnehmers um die nachgewiesenen Kosten.
Die Erstattung von Ladestromkosten für ein privates E-Fahrzeug eines Arbeitnehmers an dessen privater Ladestation zuhause durch den Arbeitgeber ist steuer- und beitragsfrei nicht möglich, sondern stellt steuerpflichtigen Arbeitslohn dar.
Für dienstlich veranlasste Fahrten mit dem privaten E-Fahrzeug, welches an einer privaten E-Ladesäule aufgeladen wurde, bleibt es bei der für den Arbeitnehmer steuer- und beitragsfreien Erstattung der üblichen km-Pauschalen durch den Arbeitgeber.
Hinweis: Die unentgeltliche Wertabgabe muss durch den Arbeitgeber umsatzsteuerlich jedoch berücksichtigt werden.
Anforderung von Unterlagen durch das Finanzamt zulässig
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu befinden, ob die Anforderung von Mietverträgen, Nebenkostenabrechnungen, Mieterhöhungsschreiben, Belegen über Erhaltungsaufwand und ähnlichen Unterlagen durch das Finanzamt bei einem Vermieter von Wohnraum zulässig ist bzw. der Vermieter die Vorlage ohne Zustimmung des Mieters verweigern darf.
Eine Vermieterin hatte die Herausgabe unter Hinweis auf die fehlende Einwilligung des Mieters und nach ihrer Auffassung daraus folgenden Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) abgelehnt. Das Finanzamt hatte die Anforderung der Unterlagen mit steuerlicher Relevanz begründet.
Der BFH entschied, dass eine Anforderung von Unterlagen zum Mietverhältnis durch das Finanzamt zwar datenschutzrechtlich relevant sei, ein Vermieter allerdings nach der Abgabenordnung zur Vorlage bei steuerlicher Relevanz verpflichtet sei, in der Regel vollständig und ungeschwärzt. Das Finanzamt müsse begründen, warum eine steuerliche Relevanz vorliege und die angeforderten Unterlagen genau bezeichnen. In diesem Fall wiege das Interesse des Finanzamtes höher als das mögliche Datenschutzinteresse eines Mieters.
Vermieter sollten demnach immer nur die konkret bezeichneten Unterlagen herausgeben, um nicht mit der DSGVO in Konflikt zu geraten.
Wichtige Unterlagen, die angefordert werden können, sind:
Mietvertrag und Mieterhöhungen
Nebenkostenabrechnungen
Belege zu Instandhaltungs- und Erhaltungsaufwand
Belege über die Mieteinnahmen, z. B. Kontoauszüge
Eine Anforderung von Unterlagen, die steuerlich nicht relevant sind, ist nicht zulässig. Das Finanzamt muss verhältnismäßig vorgehen und darf keine Ausforschung anhand beliebiger Unterlagen betreiben. Herausgaben von derart angeforderten Unterlagen sind daher nicht notwendig.
⇑Eine Vermieterin hatte die Herausgabe unter Hinweis auf die fehlende Einwilligung des Mieters und nach ihrer Auffassung daraus folgenden Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) abgelehnt. Das Finanzamt hatte die Anforderung der Unterlagen mit steuerlicher Relevanz begründet.
Der BFH entschied, dass eine Anforderung von Unterlagen zum Mietverhältnis durch das Finanzamt zwar datenschutzrechtlich relevant sei, ein Vermieter allerdings nach der Abgabenordnung zur Vorlage bei steuerlicher Relevanz verpflichtet sei, in der Regel vollständig und ungeschwärzt. Das Finanzamt müsse begründen, warum eine steuerliche Relevanz vorliege und die angeforderten Unterlagen genau bezeichnen. In diesem Fall wiege das Interesse des Finanzamtes höher als das mögliche Datenschutzinteresse eines Mieters.
Vermieter sollten demnach immer nur die konkret bezeichneten Unterlagen herausgeben, um nicht mit der DSGVO in Konflikt zu geraten.
Wichtige Unterlagen, die angefordert werden können, sind:
Mietvertrag und Mieterhöhungen
Nebenkostenabrechnungen
Belege zu Instandhaltungs- und Erhaltungsaufwand
Belege über die Mieteinnahmen, z. B. Kontoauszüge
Eine Anforderung von Unterlagen, die steuerlich nicht relevant sind, ist nicht zulässig. Das Finanzamt muss verhältnismäßig vorgehen und darf keine Ausforschung anhand beliebiger Unterlagen betreiben. Herausgaben von derart angeforderten Unterlagen sind daher nicht notwendig.
Einkommensanrechnung des Ehepartners bei Grundrente nicht verfassungswidrig
Bei der Berechnung der Grundrente wird das zu versteuernde Einkommen des Ehepartners im Gegensatz zum zu versteuernden Einkommen des Lebenspartners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft angerechnet. Diese Regelung hat das Bundessozialgericht (BSG) in seiner Entscheidung am 27.11.2025 als verfassungskonform erachtet.
Die Ungleichbehandlung ist nach dem Urteil des Gerichts hinreichend sachlich gerechtfertigt. Gewährt die gesetzliche Rentenversicherung aus finanziellen Mitteln des Bundes zum sozialen Ausgleich steuerfinanzierte Leistungen, so hat der Gesetzgeber einen weiten Spielraum, da es um den Grundbedarf geht.
Eheleute sind einander im Gegensatz zu Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft von Gesetzes wegen zur Gewährung von Unterhalt verpflichtet. Der Grundrentenzuschlag wird in Abhängigkeit vom „Grundrentenbedarf“ gewährt. Der Gesetzgeber geht allerdings davon aus, dass eine verheiratete Person besser abgesichert ist als eine unverheiratete. Das ist eine sachliche Erwägung. Sie beruht auf nachvollziehbaren Lebenssachverhalten und ist daher nicht willkürlich. Daher ist die Regelung nicht verfassungswidrig.
⇑Die Ungleichbehandlung ist nach dem Urteil des Gerichts hinreichend sachlich gerechtfertigt. Gewährt die gesetzliche Rentenversicherung aus finanziellen Mitteln des Bundes zum sozialen Ausgleich steuerfinanzierte Leistungen, so hat der Gesetzgeber einen weiten Spielraum, da es um den Grundbedarf geht.
Eheleute sind einander im Gegensatz zu Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft von Gesetzes wegen zur Gewährung von Unterhalt verpflichtet. Der Grundrentenzuschlag wird in Abhängigkeit vom „Grundrentenbedarf“ gewährt. Der Gesetzgeber geht allerdings davon aus, dass eine verheiratete Person besser abgesichert ist als eine unverheiratete. Das ist eine sachliche Erwägung. Sie beruht auf nachvollziehbaren Lebenssachverhalten und ist daher nicht willkürlich. Daher ist die Regelung nicht verfassungswidrig.
Workation: Was Arbeitgeber und Arbeitnehmer beachten müssen
Ermöglichen in Deutschland ansässige Unternehmen ihrer Belegschaft das kurzfristige mobile Arbeiten aus dem Ausland, auch Workation genannt, ist dies für viele Jobsuchende eines von mehreren Kriterien, sich für oder gegen eine Arbeitsaufnahme in dem betreffenden Unternehmen oder für einen Jobwechsel zu entscheiden. Mittlerweile erwarten laut einer Workation-Studie deutlich mehr als die Hälfte der Beschäftigten von ihren Arbeitgebern, dass mobiles Arbeiten nicht nur im Inland, sondern auch aus dem Ausland ermöglicht wird.
Gleichwohl sind sowohl die Unternehmen als auch die Beschäftigten oft nicht hinreichend über die rechtlichen und steuerlichen Voraussetzungen und Folgen informiert. In den Arbeitsverträgen und Zusatzvereinbarungen finden sich häufig keine rechtssicheren Vereinbarungen.
Deutlich definierte Regelungen sind allein aus Haftungsgründen sehr wichtig. Die Unternehmen sollten daher steuer-, arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Regelungen vorab prüfen bzw. prüfen lassen. Workation ist deutlich abzugrenzen von einer dauerhaften Tätigkeit im Ausland für das Unternehmen, aber auch die Arbeit in einer ausländischen Niederlassung eines deutschen Unternehmens stellt keine Workation dar.
Folgende Punkte sollten vorab geklärt bzw. vertraglich vereinbart werden:
Achtung: Wer ohne Arbeitserlaubnis arbeitet, gilt als illegal beschäftigt, kann ggf. ausgewiesen und mit Einreiseverboten belegt werden. Für den Arbeitgeber kann ein derartiges Vorgehen zu einer Gewerbeuntersagung mit hohen Bußgeldern führen.
Die Beachtung der sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen und Folgen sind ebenfalls wichtig.
Wenn ein Arbeitgeber einer Workation im EU-Ausland zustimmt, gilt dieser Umstand sozialversicherungsrechtlich als Entsendung. Der Arbeitgeber verpflichtet sich damit, für das Bestehen eines Krankenversicherungsschutzes seiner Mitarbeiter und der mitreisenden Familienangehörigen zu haften bzw. dafür Sorge zu tragen, dass dieser besteht.
Die vorübergehende Entsendung eines Mitarbeiters aus Deutschland im Auftrag des inländischen Unternehmens in das europäische Ausland muss im Voraus zeitlich befristet sein. Das Entgelt muss in Deutschland abgerechnet werden. Eine Auslandsentsendung liegt nicht vor, wenn die entsandte Person im Ausland lebt und von einem deutschen Unternehmen für eine Tätigkeit in ihrem Heimatstaat oder einem anderen Land eingestellt wird. Die Person darf vor der Tätigkeit nicht in Deutschland beschäftigt gewesen sein oder zuvor in Deutschland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt gehabt haben.
⇑Gleichwohl sind sowohl die Unternehmen als auch die Beschäftigten oft nicht hinreichend über die rechtlichen und steuerlichen Voraussetzungen und Folgen informiert. In den Arbeitsverträgen und Zusatzvereinbarungen finden sich häufig keine rechtssicheren Vereinbarungen.
Deutlich definierte Regelungen sind allein aus Haftungsgründen sehr wichtig. Die Unternehmen sollten daher steuer-, arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Regelungen vorab prüfen bzw. prüfen lassen. Workation ist deutlich abzugrenzen von einer dauerhaften Tätigkeit im Ausland für das Unternehmen, aber auch die Arbeit in einer ausländischen Niederlassung eines deutschen Unternehmens stellt keine Workation dar.
Folgende Punkte sollten vorab geklärt bzw. vertraglich vereinbart werden:
- Innerbetriebliche Regelungen sollten klarstellen, welche Beschäftigungsgruppen das Workation-Angebot nutzen können.
- Bei einer vorübergehenden Workation bis zu 4 Wochen gilt deutsches Arbeitsrecht, Feiertage am Arbeitsort gelten auch für den Beschäftigten.
- Bei einer länger als 4 Wochen andauernden Workation muss das Unternehmen den Beschäftigten einen schriftlichen Nachweis hierüber sowie weitere Angaben aushändigen, z. B. über die Dauer des Aufenthalts und die Währung, in der das Arbeitsentgelt gezahlt wird (Nachweisgesetz).
- Bei einer mehr als 6 Monate andauernden Workation gilt das Arbeitsrecht des Workation-Landes im Hinblick auf Entlohnung, Kündigungsfristen, Arbeitszeiten und Urlaubsansprüche.
- Längere Workation in Nicht-EU-Ländern führen i. d. R. zur Notwendigkeit eines Visums, ein Touristenvisum ist nicht ausreichend. Ggf. ist ein Arbeits- oder spezielles Workationsvisum zu beantragen, welches es in einigen Ländern bereits gibt.
Achtung: Wer ohne Arbeitserlaubnis arbeitet, gilt als illegal beschäftigt, kann ggf. ausgewiesen und mit Einreiseverboten belegt werden. Für den Arbeitgeber kann ein derartiges Vorgehen zu einer Gewerbeuntersagung mit hohen Bußgeldern führen.
- Innerhalb der EU, der EWR und der Schweiz können Beschäftigte sich zu Arbeitszwecken uneingeschränkt aufhalten. Ein Visum wird nicht benötigt. Allerdings sind in den meisten Ländern Melde- oder Registrierpflichten zu beachten.
- Wer max. 183 Tage im Jahr im Ausland arbeitet, bleibt in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, bei längerem Aufenthalt entsteht die Steuerpflicht im Ausland.
- Dauert eine Workation länger als 4 Wochen, muss insbesondere der Arbeitgeber arbeits- und steuerrechtliche Folgen beachten. Hierüber sollte der Arbeitgeber sich auch immer selbstständig informieren.
Die Beachtung der sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen und Folgen sind ebenfalls wichtig.
- Bei einer Workation im Drittland - außerhalb der EU - muss geprüft werden, ob zwischen Deutschland und dem jeweiligen Staat ein Sozialversicherungsabkommen besteht. Diese Information sollte rechtzeitig eingeholt werden. Beratung bzw. Rücksprache mit einer Fachkraft in Auslandsentsendungsfragen ist hier hilfreich.
- Bei einer Workation innerhalb der EU, EWR oder Schweiz benötigt der Arbeitnehmer eine sog. A1-Bescheinigung, die dem Nachweis der Versicherungszugehörigkeit dient und elektronisch vom Arbeitgeber oder Arbeitnehmer beantragt werden kann.
- Zu beachten ist, dass auch Grenzgänger seit 2025 eine solche A1-Bescheinigung benötigen, selbst wenn keine Workation stattfindet.
Wenn ein Arbeitgeber einer Workation im EU-Ausland zustimmt, gilt dieser Umstand sozialversicherungsrechtlich als Entsendung. Der Arbeitgeber verpflichtet sich damit, für das Bestehen eines Krankenversicherungsschutzes seiner Mitarbeiter und der mitreisenden Familienangehörigen zu haften bzw. dafür Sorge zu tragen, dass dieser besteht.
Die vorübergehende Entsendung eines Mitarbeiters aus Deutschland im Auftrag des inländischen Unternehmens in das europäische Ausland muss im Voraus zeitlich befristet sein. Das Entgelt muss in Deutschland abgerechnet werden. Eine Auslandsentsendung liegt nicht vor, wenn die entsandte Person im Ausland lebt und von einem deutschen Unternehmen für eine Tätigkeit in ihrem Heimatstaat oder einem anderen Land eingestellt wird. Die Person darf vor der Tätigkeit nicht in Deutschland beschäftigt gewesen sein oder zuvor in Deutschland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt gehabt haben.
Beitrag zur freiwilligen privaten Pflegeversicherung als Sonderausgabe
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat als Revisionsinstanz entschieden, dass neben den Beiträgen zu einer privaten Basiskrankenversicherung lediglich die Beiträge zur privaten Pflegepflichtversicherung der Höhe nach unbeschränkt als Sonderausgaben im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung abzugsfähig sind. Für Beiträge zu einer privaten Pflegezusatzversicherung gelte dies jedoch nicht. Diese Beiträge sind nur beschränkt abzugsfähig und wirken sich häufig beim Steuerpflichtigen steuerlich nicht aus.
Im Ergebnis hatten sowohl das Veranlagungsfinanzamt im Besteuerungsverfahren als auch das Hessische Finanzgericht in 1. Instanz so entschieden.
Die Kläger waren der Auffassung, dass ein Verstoß gegen die Verfassung vorliege, wenn im Fall der Pflegebedürftigkeit, insbesondere bei stationärer Pflege, Pflegebedürftige wegen hoher Eigenanteile zu „Almosenbettlern“ degradiert würden. Der Staat müsse die Beiträge zur privaten Pflegezusatzversicherung daher zumindest steuerlich anerkennen und hierdurch eine gewisse finanzielle Entlastung der Steuerpflichtigen fördern.
Der BFH hingegen vertritt die Auffassung, dass der Gesetzgeber zunächst absichtlich lediglich eine Teilabsicherung der Bevölkerung als Vorsorge gegen Pflegebedürftigkeit vorgesehen hat. Nachdem dann erkannt worden sei, dass das umlagefinanzierte Pflegeversicherungssystem Lücken aufweise, habe der Gesetzgeber als ergänzende förderungswürdige Vorsorge die Pflegevorsorgezulage ins Leben gerufen und nicht eine private Pflegezusatzversicherung. Diese Zulage haben die Kläger aber nicht nutzen wollen, weil sie die Tarife als ungünstiger einstuften.
Es ist nach der Entscheidung des BFH jedoch verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn der Gesetzgeber lediglich den Teil steuerlich freistellt, den er als verpflichtend einstuft und dem Schutz vor der Inanspruchnahme von Sozialhilfe dienen soll.
⇑Im Ergebnis hatten sowohl das Veranlagungsfinanzamt im Besteuerungsverfahren als auch das Hessische Finanzgericht in 1. Instanz so entschieden.
Die Kläger waren der Auffassung, dass ein Verstoß gegen die Verfassung vorliege, wenn im Fall der Pflegebedürftigkeit, insbesondere bei stationärer Pflege, Pflegebedürftige wegen hoher Eigenanteile zu „Almosenbettlern“ degradiert würden. Der Staat müsse die Beiträge zur privaten Pflegezusatzversicherung daher zumindest steuerlich anerkennen und hierdurch eine gewisse finanzielle Entlastung der Steuerpflichtigen fördern.
Der BFH hingegen vertritt die Auffassung, dass der Gesetzgeber zunächst absichtlich lediglich eine Teilabsicherung der Bevölkerung als Vorsorge gegen Pflegebedürftigkeit vorgesehen hat. Nachdem dann erkannt worden sei, dass das umlagefinanzierte Pflegeversicherungssystem Lücken aufweise, habe der Gesetzgeber als ergänzende förderungswürdige Vorsorge die Pflegevorsorgezulage ins Leben gerufen und nicht eine private Pflegezusatzversicherung. Diese Zulage haben die Kläger aber nicht nutzen wollen, weil sie die Tarife als ungünstiger einstuften.
Es ist nach der Entscheidung des BFH jedoch verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn der Gesetzgeber lediglich den Teil steuerlich freistellt, den er als verpflichtend einstuft und dem Schutz vor der Inanspruchnahme von Sozialhilfe dienen soll.
Bundesfinanzhof entscheidet zur Grundsteuer im „Bundesmodell“
Der Bundesfinanzhof wird am 10.12.2025 (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) in drei Verfahren öffentlich seine Entscheidungen verkünden.
Dies ist insbesondere für Grundstückseigentümer in den Bundesländern interessant, welche die Grundsteuerreform nach dem Bundesmodell umgesetzt haben. Dies sind die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Das Saarland und Sachsen nutzen ebenfalls die Bundesregelungen mit Abweichungen bei der Steuermesszahl.
Das Bundesmodell stellt den Grundstückwert für Wohngrundstücke anhand der Grundstücks- und Wohnfläche sowie des Bodenrichtwerts, Gebäudeart und Baujahr fest. Die drei Verfahren, die zur Entscheidung anstehen, haben gemeinsam, dass die Verfassungsmäßigkeit des für Grundsteuerzwecke pauschalierten Ertragswertverfahrens streitig ist.
Das pauschalierte Ertragswertverfahren findet Anwendung auf Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke und Eigentumswohnungen. Auch für die Erbschaft- und Schenkungsteuer wird teilweise das Ertragswertverfahren angewendet, allerdings im Gegensatz zur Grundsteuer wird dort z. B. nach den tatsächlichen Nettomieten bewertet und nicht nach landeseinheitlich geltenden Nettokaltmieten. Eine Unterscheidung gibt es bei der Grundsteuer lediglich nach Gebäudeart, Baujahr und Wohnflächengruppe, die über Zu- und Abschläge zum Ausdruck gebracht werden. So findet z. B. auch keine Unterscheidung der Mietniveaustufen nach Stadtlage oder ländlicher Lage statt.
Die Frage, die der BFH zu beantworten haben wird, ist, ob es mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist, in einer Vielzahl von Grundsteuerverfahren mit einem grob vereinfachten Verfahrensansatz wie durch Gutachterausschüsse festgestellte Bodenrichtwerte und pauschalierte Nettokaltmieten den Wert eines Grundstücks bzw. einer Wohneinheit zu bestimmen.
Es sind derzeit ca. 2.000 Klageverfahren zu unterschiedlichen Grundsteuermodellen rechtshängig, beim BFH sind es 15 Verfahren.
⇑Dies ist insbesondere für Grundstückseigentümer in den Bundesländern interessant, welche die Grundsteuerreform nach dem Bundesmodell umgesetzt haben. Dies sind die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Das Saarland und Sachsen nutzen ebenfalls die Bundesregelungen mit Abweichungen bei der Steuermesszahl.
Das Bundesmodell stellt den Grundstückwert für Wohngrundstücke anhand der Grundstücks- und Wohnfläche sowie des Bodenrichtwerts, Gebäudeart und Baujahr fest. Die drei Verfahren, die zur Entscheidung anstehen, haben gemeinsam, dass die Verfassungsmäßigkeit des für Grundsteuerzwecke pauschalierten Ertragswertverfahrens streitig ist.
Das pauschalierte Ertragswertverfahren findet Anwendung auf Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke und Eigentumswohnungen. Auch für die Erbschaft- und Schenkungsteuer wird teilweise das Ertragswertverfahren angewendet, allerdings im Gegensatz zur Grundsteuer wird dort z. B. nach den tatsächlichen Nettomieten bewertet und nicht nach landeseinheitlich geltenden Nettokaltmieten. Eine Unterscheidung gibt es bei der Grundsteuer lediglich nach Gebäudeart, Baujahr und Wohnflächengruppe, die über Zu- und Abschläge zum Ausdruck gebracht werden. So findet z. B. auch keine Unterscheidung der Mietniveaustufen nach Stadtlage oder ländlicher Lage statt.
Die Frage, die der BFH zu beantworten haben wird, ist, ob es mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist, in einer Vielzahl von Grundsteuerverfahren mit einem grob vereinfachten Verfahrensansatz wie durch Gutachterausschüsse festgestellte Bodenrichtwerte und pauschalierte Nettokaltmieten den Wert eines Grundstücks bzw. einer Wohneinheit zu bestimmen.
Es sind derzeit ca. 2.000 Klageverfahren zu unterschiedlichen Grundsteuermodellen rechtshängig, beim BFH sind es 15 Verfahren.
Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge wird verlängert
Das Bundeskabinett hat am 15.10.2025 beschlossen, dass die KFZ-Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 2035 verlängert werden soll. Die erste Lesung im Bundestag hat am 14.11.2025 stattgefunden. Der Gesetzentwurf wurde zur weiteren Debatte in die Fachausschüsse verwiesen.
Die Steuerbefreiung soll für Fahrzeuge gelten, die spätestens bis zum 31.12.2030 erstmalig für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen werden. Die Steuerbefreiung gilt bis zu 10 Jahre, längstens jedoch bis zum 31.12.2035.
Die Stellungnahme des Bundesrates steht noch aus.
Ohne eines Änderung des Gesetzes wären nur noch reine Elektrofahrzeuge von der KFZ-Steuer befreit, die vor dem 1.1.2026 erstmalig zugelassen werden.
⇑Die Steuerbefreiung soll für Fahrzeuge gelten, die spätestens bis zum 31.12.2030 erstmalig für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen werden. Die Steuerbefreiung gilt bis zu 10 Jahre, längstens jedoch bis zum 31.12.2035.
Die Stellungnahme des Bundesrates steht noch aus.
Ohne eines Änderung des Gesetzes wären nur noch reine Elektrofahrzeuge von der KFZ-Steuer befreit, die vor dem 1.1.2026 erstmalig zugelassen werden.
Umsatzsteuerfreiheit für unmittelbare Schul- und Bildungsleistungen
Anfang des Jahres 2025 war eine Neuregelung zur Umsatzsteuerfreiheit für unmittelbare Schul- und Bildungsleistungen in Kraft getreten, da diese den EU-Vorgaben angepasst wurde. In der Praxis hat die Neuregelung zu Unklarheiten geführt. Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat daher am 24.10.2025 eine neue Verwaltungsanweisung mit einer Übergangsregelung veröffentlicht und diese auch der aktuellen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur Umsatzsteuerbefreiung von Bildungsleistungen angepasst.
Hiernach wird es nicht beanstandet, wenn Umsätze aus Bildungsleistungen, die vor dem 1.1.2028 ausgeführt wurden bzw. noch werden, entsprechend den bis zum 31.12.2024 geltenden Regelungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses als umsatzsteuerfrei bzw. umsatzsteuerpflichtig behandelt werden.
Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die mit der Erbringung von unmittelbaren Schul- und Bildungsleistungen betraut sind, gelten für diese Leistungen als von der Umsatzsteuer befreit. Folgende Leistungen sind demnach umsatzsteuerfrei: Schul- und Hochschulunterricht, Aus- und Fortbildung sowie berufliche Umschulung.
Für Privatlehrer wurde ein separater Befreiungstatbestand aufgenommen.
⇑Hiernach wird es nicht beanstandet, wenn Umsätze aus Bildungsleistungen, die vor dem 1.1.2028 ausgeführt wurden bzw. noch werden, entsprechend den bis zum 31.12.2024 geltenden Regelungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses als umsatzsteuerfrei bzw. umsatzsteuerpflichtig behandelt werden.
Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die mit der Erbringung von unmittelbaren Schul- und Bildungsleistungen betraut sind, gelten für diese Leistungen als von der Umsatzsteuer befreit. Folgende Leistungen sind demnach umsatzsteuerfrei: Schul- und Hochschulunterricht, Aus- und Fortbildung sowie berufliche Umschulung.
Für Privatlehrer wurde ein separater Befreiungstatbestand aufgenommen.
Keine erste Tätigkeitsstätte bei unbefristetem Leiharbeitsverhältnis
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass dem unbefristet beschäftigten Arbeitnehmer im Rahmen eines Leiharbeitsverhältnisses üblicherweise keine erste Tätigkeitsstätte zugeordnet werden kann, auch dann nicht, wenn er dauerhaft im Rahmen des Leiharbeitsverhältnisses in einem Betrieb eingesetzt wird.
Der im Rahmen eines zunächst befristeten und später unbefristeten Leiharbeitsverhältnisses beschäftigte Arbeitnehmer wurde langfristig in dem gleichen Betrieb eingesetzt.
Im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung machte er die entstandenen Fahrtkosten zu seinem Einsatzort nicht als Werbungskosten geltend, sondern mit den höheren, für ihn vorteilhafteren Fahrtkostenpauschalen als Auswärtstätigkeit.
Dies hat das Finanzamt abgelehnt und lediglich den Werbungskostenabzug zugelassen. Der BFH hat sich jedoch der Auffassung des Klägers angeschlossen.
Zur Begründung führte der BFH aus, dass die Tätigkeit eines Leiharbeitnehmers aufgrund der Vereinbarung zwischen Entleiher und Verleiher in der Regel lediglich eine vorübergehende und keine dauerhafte Tätigkeit im Betrieb des Entleihers darstellt. Darüber hinaus gelte seit April 2017 die Regelung, dass ein Leiharbeitnehmer nicht länger als 18 Monate im gleichen Betrieb beschäftigt werden dürfe, was in der Regelung für eine nicht dauerhafte Beschäftigung im gleichen Betrieb spreche. Grundsätzlich ist bei einem Leiharbeitnehmer davon auszugehen, dass ein vorübergehender und kein dauerhafter Einsatzort gegeben sei.
Da der Werbungskostenabzug bei einer dauerhaften ersten Tätigkeitsstätte erfolgt, bei vorübergehender Tätigkeit mit üblicherweise wechselnden Tätigkeitsstätten die höheren Fahrtkostenpauschalen für Auswärtstätigkeit in Abzug gebracht werden können, gab der BFH der Klage statt.
⇑Der im Rahmen eines zunächst befristeten und später unbefristeten Leiharbeitsverhältnisses beschäftigte Arbeitnehmer wurde langfristig in dem gleichen Betrieb eingesetzt.
Im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung machte er die entstandenen Fahrtkosten zu seinem Einsatzort nicht als Werbungskosten geltend, sondern mit den höheren, für ihn vorteilhafteren Fahrtkostenpauschalen als Auswärtstätigkeit.
Dies hat das Finanzamt abgelehnt und lediglich den Werbungskostenabzug zugelassen. Der BFH hat sich jedoch der Auffassung des Klägers angeschlossen.
Zur Begründung führte der BFH aus, dass die Tätigkeit eines Leiharbeitnehmers aufgrund der Vereinbarung zwischen Entleiher und Verleiher in der Regel lediglich eine vorübergehende und keine dauerhafte Tätigkeit im Betrieb des Entleihers darstellt. Darüber hinaus gelte seit April 2017 die Regelung, dass ein Leiharbeitnehmer nicht länger als 18 Monate im gleichen Betrieb beschäftigt werden dürfe, was in der Regelung für eine nicht dauerhafte Beschäftigung im gleichen Betrieb spreche. Grundsätzlich ist bei einem Leiharbeitnehmer davon auszugehen, dass ein vorübergehender und kein dauerhafter Einsatzort gegeben sei.
Da der Werbungskostenabzug bei einer dauerhaften ersten Tätigkeitsstätte erfolgt, bei vorübergehender Tätigkeit mit üblicherweise wechselnden Tätigkeitsstätten die höheren Fahrtkostenpauschalen für Auswärtstätigkeit in Abzug gebracht werden können, gab der BFH der Klage statt.
Die Frühstartrente
Die sogenannte Frühstartrente soll in Deutschland eingeführt werden und darauf abzielen, Eltern bei der frühzeitigen Altersvorsorge ihrer Kinder zu unterstützen und hierdurch von Zinseszinseffekten zu profitieren. Hierdurch soll das Rentensystem für die Zukunft entlastet werden. Ob diese, wie zunächst angedacht, Anfang 2026 in Kraft treten kann, ist derzeit unklar, da bislang kein Referenten- oder Gesetzesentwurf vorliegt. Es soll eine Verknüpfung der Frühstartrente mit einer Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge erfolgen.
Kinder ab dem 6. Lebensjahr sollen offenbar ohne Antrag ein staatlich gefördertes Wertpapierdepot erhalten, in das zwischen dem 6. und 18. Lebensjahr monatlich 10 € eingezahlt werden. Ab dem 18. Lebensjahr können dann durch das nunmehr volljährige Kind ab 50 € bis zu 100 € monatlich in den Vertrag eingezahlt werden. Anders lautende Vorschläge aus der Versicherungswirtschaft liegen vor.
Bei einer angenommenen gewogenen Rendite von 6 % pro Jahr und ohne jegliche eigene Einzahlungen ergibt sich laut nachfolgendem Beispiel 1 ein Rentenkapital von ca. 36.000 € bzw. über 20 Jahre eine monatliche Rente von 216 €. Im Beispiel 2 wird ab dem 18. Lebensjahr von der Annahme ausgegangen, dass monatlich 100 € in den Vertrag eingezahlt werden, sodass sich zusätzlich zu dem staatlichen Zuschuss ein Rentenkapital von ca. 374.000 € ergibt bzw. eihne monatliche Rente von 2.200 €.
Der Vertrag kann vor dem 67. Lebensjahr nicht aufgelöst und das Kapital auch nicht für andere Zwecke verwendet werden. Gesetzt den Fall, das Renteneintrittsalter würde sich z. B. auf 70 Jahre erhöhen, würde sich im Beispiel 1 das Rentenkapital wegen der um 3 Jahre längeren Liegezeit geringfügig erhöhen, während es sich im Beispielsfall 2 durch die höheren Einzahlungen mehr erhöht. Zu dem Thema „Steuerpflicht der Erträge“ gibt es noch keine Aussage.
Welche erbrechtlichen Vorstellungen der Gesetzgeber z. B. für den Fall des Todes des Berechtigten vor (vollständigem) Bezug der Rente hat, ist noch nicht bekannt.
⇑Kinder ab dem 6. Lebensjahr sollen offenbar ohne Antrag ein staatlich gefördertes Wertpapierdepot erhalten, in das zwischen dem 6. und 18. Lebensjahr monatlich 10 € eingezahlt werden. Ab dem 18. Lebensjahr können dann durch das nunmehr volljährige Kind ab 50 € bis zu 100 € monatlich in den Vertrag eingezahlt werden. Anders lautende Vorschläge aus der Versicherungswirtschaft liegen vor.
Bei einer angenommenen gewogenen Rendite von 6 % pro Jahr und ohne jegliche eigene Einzahlungen ergibt sich laut nachfolgendem Beispiel 1 ein Rentenkapital von ca. 36.000 € bzw. über 20 Jahre eine monatliche Rente von 216 €. Im Beispiel 2 wird ab dem 18. Lebensjahr von der Annahme ausgegangen, dass monatlich 100 € in den Vertrag eingezahlt werden, sodass sich zusätzlich zu dem staatlichen Zuschuss ein Rentenkapital von ca. 374.000 € ergibt bzw. eihne monatliche Rente von 2.200 €.
Der Vertrag kann vor dem 67. Lebensjahr nicht aufgelöst und das Kapital auch nicht für andere Zwecke verwendet werden. Gesetzt den Fall, das Renteneintrittsalter würde sich z. B. auf 70 Jahre erhöhen, würde sich im Beispiel 1 das Rentenkapital wegen der um 3 Jahre längeren Liegezeit geringfügig erhöhen, während es sich im Beispielsfall 2 durch die höheren Einzahlungen mehr erhöht. Zu dem Thema „Steuerpflicht der Erträge“ gibt es noch keine Aussage.
Welche erbrechtlichen Vorstellungen der Gesetzgeber z. B. für den Fall des Todes des Berechtigten vor (vollständigem) Bezug der Rente hat, ist noch nicht bekannt.
| Beispiel 1: Nur staatliche Förderung (ohne Eigenbeiträge) | |
| Einzahlung (6. bis 18. Lebensjahr) | 1.440 € (10 €/Monat) |
| Rendite | 6,00 %/Jahr |
| Zeitraum (18. bis 67. Lebensjahr) | 49 Jahre |
| Endvermögen | ca. 36.000 € |
| Rente | 216 €/Monat über 20 Jahre |
| Beispiel 2: Staat + Eigenbeiträge (100 €/Monat ab 18) | |
| Einzahlung (6. bis 18. Lebensjahr) | 1.440 € (10 €/Monat) |
| eigene Einzahlungen (ab dem 18. Lebensjahr) | 100 €/Monat |
| Gesamteinzahlung | 60.240 € |
| Rendite | 6,00 %/Jahr |
| Zeitraum (18. bis 67. Lebensjahr) | 49 Jahre |
| Endvermögen | ca. 374.000 € |
| Rente | 2.200 €/Monat über 20 Jahre (4 % Rendite) |
Deutschlandticket 2026
Das Deutschlandticket soll auch in den Jahren 2026 – 2030 erhalten bleiben. Der aktuelle Bezugspreis von 58 € in 2025 soll lt. Vereinbarung der Verkehrsminister der Bundesländer in 2026 auf 63 € monatlich steigen. Auch im Jahr 2026 können Zuschüsse zum Deutschlandticket durch den Arbeitgeber steuer- und sozialversicherungsfrei zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden. Der Zuschuss ist auf die Höhe der Aufwendungen des Arbeitnehmers begrenzt.
⇑